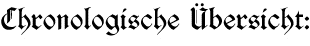|
[Bd. 2 S. 388]

Ursula Oertlin war eine innerlich stolze Markgräflerin, eine Alemannin, wie sie im vorderen Wiesental in ungebrochener Reinheit gedeihen, tief protestantisch gläubig, aufgetan dem Wesen und Weben der Landschaft, besinnlich und eher ernst als fröhlich. Dazu gesellte sich der Franke aus Simmern im Hunsrück, weltoffen und vielerfahren, geistig sehr rege, von vielen Wissensgebieten angezogen. Er soll sich mit Mathematik, mit Geographie, mit Geschichte beschäftigt haben, und er sammelte und schrieb Volks- und Soldatenlieder nieder. Er führte ein Tagebuch und dichtete sogar. Ein merkwürdiger Mann, wie es scheint, dieser Soldat und Weber. Ursula Oertlin besaß in Hausen im Wiesental ein Häuslein und Äcker, dazu ihr erspartes Geld aus dem Dienst bei Iselins. Auch der Mann hatte ein kleines Vermögen, denn er war sparsam, obschon er nicht ohne fränkische Lebensfreude gelebt hatte. Sie hinterließen später zweitausendfünfhundert Gulden Vermögen. Im Winter lebte das Paar zu Hausen im Oertlinschen Hause. Der Mann saß fleißig am Webstuhl und war Schutzbürger der Gemeinde geworden. Im Sommer dienten sie auf dem Gut bei den Iselins weiter in unwandelbarer Treue. Die Familie schätzte die beiden sehr, es herrschte ein warmes Verhältnis, besonders zwischen dem Major und seinem Begleiter. Es wurde ihnen ein Sohn geboren, Johann Peter, und danach ein Mädchen, Susanne, das beim Tode des Vaters nur ein paar Wochen alt war. Die Anstrengungen der Kriege mochten die Gesundheit des "Dragunerjobbi", wie der Vater Hebel im Dorf Hausen hieß, untergraben haben. Als sein Bub kaum [389] den ersten Schritt in der Stube allein gewagt hatte, starb der Vater, erst einundvierzig Jahre alt, weg aus der glücklichen Heimat, die er so spät erst gewonnen hatte. Bald danach schloß auch das winzige Leben des Mädchens, die Hebelin mit doppeltem Leid erfüllend. Nach wie vor wechselte die junge Witwe zwischen Basel und Hausen hin und her. So ist dann auch der Sohn in zwei Welten groß geworden, in der ländlichen Heimat Hausen und in der reichen, geistbeseelten Schweizerstadt Basel. In Hausen war er, was ein Halbwaislein sein kann, Hirtenbub, Taglöhner, Botengänger, Holzleser und Beerensucher, dazu ein übermütiger, barfüßiger Hansguckindieluft. In Basel ein artiger, stolzer Stadtbub. Er lernte gut in der Schule. Da ein kleines Geld am Zins stand, wollte die Mutter etwas Rechtes aus ihm werden lassen, das heißt, sie wollte den Traum des Vaters zur Erfüllung bringen: aus dem Sohn sollte ein "Studierter" werden. Dem Wissensdrang des Vaters waren soviel Türen verschlossen geblieben, die nun dem Sohne geöffnet werden konnten. Hanspeter Hebel hat von beiden Eltern das geerbt, was ihre Stammeseigentümlichkeit ausmacht: von der alemannischen Mutter das fromme Gemüt, die stille Beschaulichkeit, die dankbare Bescheidenheit für Gottes Ackersegen und gutes Gelingen einfacher Dinge, die ernste Lebensauffassung bei der Arbeit, Würde des Auftretens, die Muttersprache mit ihrer farbigen Fülle des Ausdrucks, den Sinn für das Dichtbare aus der Überlieferung. Die Volkserzählung, die er später so unvergeßlich meisterte, hat ihre Heimat tief im Wesen des alemannischen Volkes, und zwar besonders in der erzieherischen Gelassenheit und Überzeugungskraft des Berichtes. Dazu kam vom Vater her die leichte Hand und die heitere Sinnenfreude, die Lust an der Unterhaltung, der Zug zum Wandern, die Gabe, sich anzupassen. Auf der Landstraße zwischen Basel und Lörrach finden wir den jungen Hebel. Er sitzt auf einem Leiterwagen eines Hausener Nachbarn. Vorsichtig fahren sie dahin. Weich gebettet ruht Ursula Hebel im groben Gefährt, schlimmer krank, als die Iselins, als der Nachbar, als der dreizehnjährige Bub es ahnen. Sie indessen spürt, daß es zu Ende geht. Es litt sie nicht mehr in Basel, das Heimverlangen war übermächtig, die besorgten Iselins mußten ihr den Willen tun und sie nach Hause lassen, hoffend, sie würde dort eher gesunden. Der Oktobertag mit dem Ruch des Traubenherbstes in der Landschaft der Rebbauern, die zart verschleierte Stille über den Ruinen des einst so mächtigen Röttelner Schlosses, das Rauschen des Flusses, es ist die Wiese, all diese vertrauten Bilder des Heimatraumes haben wohl für immer im Herbst für Hebel mit dem ungewöhnlichen Tode der Mutter zusammengeklungen. Die Frau stirbt auf dem Wagen neben dem hilflosen Buben unterwegs auf der Straße ins Wiesental zwischen Bernbach und Steinen. Dies geschah im Oktober 1773. Er war nun Fremden überlassen. Da er ein kleines Erbteil besaß, konnte er sich weiter, wie es geplant war, zu seinem Berufe ausbilden. Der Präzeptor [390] Obermüller in Schopfheim nahm ihn zu sich. Hebel ist ein liebenswerter Bursche, auch sein Lehrer Grether in Hausen mochte ihn gut leiden. Hebel ist zeitlebens all den Männern, die sich seiner annahmen, als er ein Waisenbub war, dankbar geblieben. Ein Jahr nach der Mutter Tod wurde der vierzehnjährige Lateinschüler eingesegnet. Nun hieß es Abschied nehmen von der geliebten Heimat; daß es eigentlich ein Abschied ohne bleibende Rückkehr war, konnte der junge Springinsfeld nicht ahnen. Aber es ist seither ein "ewig mutterndes und bruttelndes" Gefühl in ihm geblieben, das Heimweh. Seltsam war nur, daß er nach Hausen nicht mit stürmischem Heimbegehren verlangte. Er zögerte lange, wohl weil er sein Weichwerden fürchtete und dies zu offenbaren sich schämte, bis er die Dorfheimat zum erstenmal wieder besuchte und den Spruch am Elternhaus las: "Wenn Neid und Haß brennt' wie ein Feur, wär Holz und Kohlen nicht so teur", einen Spruch, den der Vater Hebels an den Giebel geschrieben. Die Hausener hatten vielleicht dem "Hergeloffenen" nicht immer das Salz an die Suppe gegönnt. Das Hebelhaus steht heute noch, ein Wallfahrtsort zur Wiege des Geistes, wie es im Reiche viele gibt. Hebel wird nun nach Karlsruhe gebracht, in die erst sechzigjährige Stadt. Im Jahre 1715 war Karlsruhe vom Markgrafen Karl Wilhelm im Hardtwald als neuer Regierungssitz gegründet worden. Die strahlenförmig vom Schloß ausgehende Straßenordnung der "Fächerstadt" ist ja bekannt, sie war damals noch gewissermaßen im Urzustand vorhanden, ehe der große Baumeister Friedrich Weinbrenner, der Freund und Zeitgenosse Hebels, ihr ein ausgeprägteres Gesicht gab, soweit man seinen kühnen Plänen Verständnis entgegenbrachte und ihnen folgte. In Karlsruhe besuchte Johann Peter Hebel das Gymnasium. Bei Hofdiakonus Preuschen wurde er aufgenommen. Hier wohnte er und wurde er beaufsichtigt. Seine Mahlzeiten nahm er an Freitischen ein, die wohltätige Professoren minderbemittelten Schülern zur Verfügung stellten. Hebel blieb ein lernfleißiger Schüler, der zu den besten Hoffnungen Anlaß gab. Er war aber kein ehrgeiziger Streber, er fand das Leben außerhalb der Schulstube lehrreicher als die Bücher. Er trieb sich ganz gern in der klargebauten Stadt herum, soweit einem angehenden Theologen hierzu Freizeit gelassen wurde, und der Hardtwald war ihm so lieb, wie er jedem Karlsruher Kind bis auf den heutigen Tag lieb ist; denn er ist ein weiter, merkwürdiger, versteckreicher und verschwiegener Tummelplatz für Knabenspiele geblieben, ein rechter Bubenhimmel, unvergeßlich bis ins hohe Alter. Hebel machte 1778 seine Abgangsprüfung am Karlsruher Gymnasium und wird Student in Erlangen. Es sind hierzu des zu kleinen Erbteils wegen Stiftgelder nötig und Gönnerschaften. Hebel scheint ihrer würdig. Sie erwarten alle, daß er seine Prüfung mit bester Note hinter sich bringt und dann im heiligen Berufe aufsteigt zu hohen Stellen. Sie hatten sich vorerst ein wenig verrechnet. Die Prüfungen Hebels fielen nicht besonders gut aus. Das Wissen des Anwärters ward [391] mittelmäßig befunden. Wie ging das zu bei diesem hochbegabten, seinem mit Freuden gewählten Berufe entgegenstrebenden Hebel? Die vererbte Gemütsart des Vaters drückte wahrscheinlich beim männlich bewußten Studiosus Hebel den Daumen auf die besinnliche Pflichterfüllung des mütterlichen Erbes, und das Füllen schlug über die Stränge. Es gibt Leute, die Hebels Leben bis in seine Alltäglichkeit erforscht haben, die allerlei munkeln über seine Erlanger Zeit. Sein Alibi soll für einige Monate nicht beizubringen sein, es klafft eine Lücke im Daseinsbericht des Helden. Das hätte bei einem Theologen, dem man die Seelen der Gläubigen anvertraute, nicht sein dürfen. So viel ist herausgekommen, Hebel hat auch davon Zeugnis genug gegeben in seinem Schrifttum, daß er ein feuchtfröhlicher, lustiger Student gewesen ist, einen Hund sein eigen nannte, dem Tabakrauchen frönte. Er soll bei den Moselanern aktiv geworden sein, obschon Studentenverbindungen verboten waren. Er soll auch vorgehabt haben, zu einer anderen Fakultät umzusatteln. Aber welcher rege, junge Student hat dies nicht während des Studiums einmal vorgehabt? Und dazu ein lebensheiterer Theologe, den die Frau Welt in ihren Arm nehmen mußte, weil er ein Sonntagskind war und sein Wesen einnahm. Buchwissen, das bekennt er frei, war ihm nicht wichtig, es grauste ihm vor der dicken Gewichtigkeit der Pandekten, die er zu wälzen hatte. Er sah Gottes Allwissen und Allmächtigkeit deutlicher draußen in der Natur sich offenbaren als im Buchstaben, deutlicher im Tönen der Musik, selbst im Volkslied aus rauhem Munde. Er erlebte ihn im Dröhnen des Gewitters aus den Gewalten des Himmels eher als aus den steifen Sätzen dogmatischer Gelehrten. Gott ist der einfache, große Gott des Volkes – dies erkennt er früh, er ist nicht die unfaßliche, vielnamige Wesenheit über den Dingen. Die Theologie des kurpfälzischen unruhigen Soldaten- und Webersohnes und des Sohnes einer alemannischen, landschaftsverbundenen, erdentwachsenen Mutter, die vom Mythischen soviel gewußt hatte, diese Theologie brauchte nur Liebe, Freude, Einfachheit als Grundlage des Gottesdienstes, keine Lehrmeinungen um Gottes Wissenschaft. Hebel hat, wie jeder tiefe Gläubige, Gott suchen müssen und um Erkenntnisse gerungen. Er fand ihn auf den Wegen des Herzens von Mensch zu Mensch und auf den Wanderungen in der Natur zu den Lebewesen. War es Pech nun oder mangelhafte Vorbereitung, der tadelnswerte Ausgang der Prüfung traf seine hoffnungsvollen Gönner hart. Sie wurden recht ungehalten, ja sie mißtrauten seinem Können auch in Zukunft. Die Strafe für diese Enttäuschung blieb für Hebel nicht aus. Er mußte fast ein Dutzend Jahre lang sich mit Geduld und einem winzigen Gehalt begnügen, ehe er fest angestellt wurde. Er nahm eine Hauslehrerstelle beim kranken Pfarrer Schlotterbeck in Hertingen an und zog unbekümmert in das Oberland hinauf. Hertingen, das liebliche, zwischen Hügelwellen gebettete Rebdorf im Markgräflerland, blieb ihm mit all seiner ländlichen Fülle des Menschen-, Tier- und Pflanzenlebens, der Idylle und [392] der Größe der Natur in unvergeßlichen inneren Bildern aufbewahrt. Dort schlug der Dichter in ihm die Augen auf und sah unersättlich die Welt im Kleinen das körperhafte Leben, im Käfer und im Baum, im Gras und im Wasser. Noch war er nicht reif zur dichterischen Tat, er wußte nichts von dem helläugigen Schauen in seiner heimlichen Kammer. Viele Jahre später erst sollte er gewahr werden, welche Kräfte in ihm auf ihre Zeit warteten. Dem Vorschlag des Pfarrers Schlotterbeck wurde schließlich im Jahre 1782 stattgegeben, den Johann Peter Hebel auch zum Kirchenamt zu berechtigen. So betrat er in Hertingen erstmals die Kanzel als Prediger. Im übrigen war er zufrieden, daß die Heimat ihn mit all ihrem Segen der Landschaft umfing vom Blauen bis an den Rhein, vom Belchen bis zum Feldberg, wo die vielbesungene Wiese, "Feldbergs liebliche Tochter", entspringt, wo die Schweiz mit ihren Schneefirnen sich fern an den Himmel zeichnete, wo das Elsaß stromüberwärts in grüner Ebene lag, im blauen Schatten der Vogesen. Hebel, der Wanderer, setzte überall hin in der Runde seine unermüdlichen Füße, und seine Augen schweiften dem Herzen zuwett über das Kleine und über das Große. Er war ein liebender Beobachter, und er beugte sich mit Lust über Käfer und Blume, um Gottes Geschöpf ganz nahe zu sein. Nicht nur in Hertingen, auch in den nachfolgenden Jahren als Präzeptoratsvikar in Lörrach hat er den tiefen, geheimnisvollen Unterbau zu seinem dichterischen Werk geschaffen, ahnungslos sammelnd, wovon er später seine Seele in der Fremde nähren und sein Heimweh beschwichtigen konnte mit den Bildern der Heimat. Was ihm an Gehalt abging, mit dem er sein Dasein wahrhaft notdürftig nur bestritt, konnte ihn nicht verbittern und verwirren, das Glück der Freiheit in seinen Mußestunden überwog die täglichen Sorgen. Er gewann viele Freunde, besonders als er im Jahre 1783 als Lehrpfarrer ans Lörracher Gymnasium kam, woselbst er neben Religionsunterricht Latein und Griechisch als Lehrfach erteilen mußte. Er erwies sich als besonders begabter Lehrer, die Prüfungen fielen diesmal für ihn günstig aus. Die Stelle war aber untergeordnet und mager besoldet. Große Sprünge konnte der junge Hebel nicht machen; dennoch lebte er für damalige Verhältnisse in großem Zuge. Er unternahm viele Wanderfahrten. Von Hertingen aus war er zum zweiten Male in die rheinische Heimat des Vaters gereist; die erste Reise nach Simmern hatte er schon als Karlsruher Gymnasiast gemacht. Er war kein Stubenhocker, das Fernweh, er selber nennt es etwas "Vagabundisches", trieb ihn um, das schweifende Vaterblut war lebendig in ihm. Die Zeit indessen mit dem blühenden Bürgertum in den Städten hatte für Abenteuer und Unruhe, weil sie unbehaglich waren, kein Verständnis. So mußte Hebel als Außenseiter gelten samt dem Freundeskreis, einem Zirkel, der, wie damals üblich, als ein Geheimbund gestaltet war, dem mehrere freizügig denkende Pfarrherren angehörten. Es waren dies Tobias Günttert in Lörrach, später in Weil, Pfarrer Friedrich Wilhelm Hitzig, ein unbekannt Gebliebener [393] den sie Bammert nannten, und Pfarrer Wilhelm Engelhart Sonntag. Sie nannten sich Proteuser nach der wandelbaren, merkwürdigen Gottheit Proteus, Hebel war Stabhalter, Günttert war Vogt der übermütigen, phantastischen, doch harmlosen Gesellschaft. Es mutet merkwürdig an, daß diese tüchtigen Theologen einer Naturbegeisterung huldigten, die an heidnisches Brauchtum erinnert. Sie nannten ihre Art zu sprechen, ihre feierlichen Handlungen, die echter Ergriffenheit entsprungen, "Belchismus". Sie erstiegen nämlich den einsamsten, königlichsten Berg des Schwarzwaldes, den unwegsamen Belchen, auf dessen Gipfel sie den Altar des großen Gottes der Natur errichteten. Ihre Geheimsprache war sonderbar; sie wandelten die Wörter, indem sie ihre Silben verdrehten, ihre Buchstaben versetzten, sie erfanden neue Wörter dazu, sie freuten sich am Sinn und Widersinn der willkürlich launischem Einfall unterworfenen Sprache. Sie nahm im Munde dieser geistvollen jungen Männer eine unfaßliche Lebendigkeit an, die Tiefsten unter ihnen spürten sehr wohl, daß ihren Unsinn keine Narrheit taub machte, es war ein schöpfungsbewußtes Wesen dabei. Es war mehr, als wenn Kinder die Wörter verdrehen; aber auch ein Kind staunt, wie auf einmal solch ein verdrehtes Wort ganz ein Wort ist, ein seltsam Ding. Warum heißt es Tag anstatt Gat, warum wird aus Maus umgekehrt Saum und aus Gras Sarg? Ja warum? Das Lebendige der Sprache ist so geheim im Ursprung wie der Atem im Leib aus Erde. Man muß wissen, in jener Zeit, wo die sogenannte bürgerliche Welt von modischem Geist der Wirklichkeitsmächte, der behaglichen Lebensweise im flachen Lande, in abgezirkelten Stadtbildern, um abgezirkelte Beete, unterm abgezirkelten Wuchs der Bäume in Zirkeln sich sammelte, gemeinsam das gleiche dachte und das gleiche wollte, dem Willen des Fürsten untertan, der Güte huldigend, die nicht sonderlich anstrengt, dem lauen Fühlen, das eher entsagte als kämpfte, friedfertig folgend, in jener Zeit stieg man nicht auf die Gipfel der Berge. Der Mensch war gipfelfremd geworden. Die Zeit, da kühne Ritter Burgen auf wilde Kuppen bauten, war längst vorbei, die steinernen Adlerhorste der Gotik waren zerfallen. Doch diese Pfarrherren, der Bammert soll zwar ein Aktuar gewesen sein, selbst ihre Frauen schlossen sich nicht aus, erstiegen den hohen Belchen und fanden im Erlebnis einer Sternennacht oder eines Gewitters, das unter ihren Füßen tobte, sich an das Herz der Gottheit gehoben, über den kleinwinkligen Geist der Ichsucht und Enge, über das rätsellose Werkeln im Alltag. Sie kamen herab vom Berge mit leuchtenden Gesichtern, als habe der Herr im feurigen Dornbusch sie mit neuem Geiste begabt. Hebel war einer der beweglichsten Proteuser, sein rheinisches Vaterblut machte sich geltend; daß Hebel dem Belchismus mit Begeisterung huldigte, geht aus Botschaften hervor und Briefen. Es erweist aber auch das Gegenteil der allgemein üblichen Behauptungen, als sei er allzusehr der Beschaulichkeit verschworen gewesen. Wer so gegen den Strom schwamm wie er, hat tiefere Spannungen in sich, als er selber vielleicht wahr haben wollte. Es stellte sich später in Karlsruhe heraus, daß Hebel ein gutes naturwissenschaftliches Rüstzeug besaß, [394] als er mit dem Gymnasiallehrer und Naturforscher Gmelin, Hebels Landsmann aus Badenweiler und Goethes Freund, auf die Suche nach seltsamen Naturalien ging und diesen sogar eine Zeitlang im Naturkundeunterricht vertrat. Das Proteusertum war im Grunde eine Wehr des phantasiebegabten, freizügigen, geistig empfindlich gearteten Alemannen, des Bergmenschen gegen die laue seelische und geistige Ebene der städtischen Gesellschaftsmenschen. Das Entgleitenlassen des Verstandes ins Unermeßliche des Gefühls ist schon abseitiges Wollen. Gefühl wandelt sich und wandelt den Gegenstand, den es umfängt und durchdringt. Proteus ist wunderbar und wunderlich zugleich, die treibende Macht der Dichter und Schöpfer. Neben dem von ihm und seinen Freunden erfundenen und "zelebrierten" Belchismus bewegt Hebels Wesen auch die Liebe zu Gustave Fecht, der Schwester der Frau Pfarrer Günttert. Unwillkürlich erfaßt man das tragisch-wehmütig ausgehende Hin und Her zwischen Gustave und dem jungen Hanspeter Hebel als Gegenstück zu dem tragisch-wehmütig endenden Liebeswandel zwischen Goethe und Friederike Brion. Das behagliche Pfarrhaus mit Pfänderspiel, Gartenlust und Volkslied gibt für beide in der deutschen Seelengeschichte verewigten Liebespaare den sittlich sauberen Hintergrund ab. Hebel hat sich fünfunddreißig Jahre lang fast ununterbrochen mit Gustave Fecht in regem und bewegtem Briefwechsel unterhalten. Er hat alles mitgeteilt, was sein Leben betraf. Er hat ihr, die sich eingehend um die politischen Ereignisse in Deutschland kümmerte, die sich im Zeitalter der Kriegstrubel nach der Französischen Revolution, der Koalitionskriege, der Napoleonischen Kriege förmlich jagten, knappe Berichte geschickt von dem, was er erfahren konnte und mitteilen durfte. Es wird allgemein von Hebelforschern angenommen, er sei ein unpolitischer, zum mindesten ein unsoldatischer Mensch gewesen, und es wird auch auf seine lau und leidenschaftslos klingenden Briefstellen und Erzählungen, die das Gebiet der vaterländischen Politik streifen, als Beweis seiner befremdlichen Kühle gegenüber den Schicksalsstürmen, die einzelne deutsche Landschaften überbrausten, hingewiesen. Dabei vergessen wir wohl, daß die Post noch zu unsicher ging, um Botschaften zu übermitteln. Außerdem war Wohl und Wehe des Rheinbundgaues von geringfügigen Äußerungen abhängig. Einem Mann, der so nah beim Fürstenthron lebte und so tief verbunden mit Staatsmännern aller Art war, drängte sich einfach das Gebot auf, eher zu schweigen als sich mit seinem Wissen um politische Geschehnisse und Zusammenhänge zu brüsten. Hebel durfte nicht ohne weiteres seine politische Meinung äußern. Heute, da wir in Hebels Heimatraum wie damals Grenzland sehen müssen, dem Unbedachtsamkeiten zur Gefahr würden, verstehen wir wohl, weshalb der spätere Hofdiakon, Direktor des Lyzeums, Professor, Prälat, Mitglied der Ersten Kammer und was er sonst noch alles an Ämtern erreichte, die Finger von der öffentlichen Politik ließ. Er war ein kerndeutscher Mann und bewies dies durch sein Werk so vollkommen, daß es sich mit ungerechter Vermutung nicht schmälern läßt. [395] Hinzu kommt natürlich, daß in jenem Zeitraum der Jahrhundertwende das Reich zerfallen und Eigenbrötelei Trumpf war. Der großen Geister Wesen, die aufstiegen aus dem stets sich gleich bleibenden Volke, Schillers, Goethes, Jean Pauls, Kleists, der Freiheitsdichter, der Universitätslehrer, heldischer Offiziere und ihrer Kampfscharen, riß erst dann alle großen Seelen an sich, als sich ihr Werk über ihren Tod erhob. Es fehlte Hebel, wie vielen, die herzhaft gewollt hätten, die Möglichkeit großer Umschau. Die Umwelt kreiste sie ein im engen Zirkel. Hebel hatte natürlich nach allem, was aus seinen Briefen klingt, keine Neigung zur starken Gebärde des Heldischen, keine Lust am Waffenspiel. Er fand den Frieden fruchtbarer, die Milde göttlicher, das Lächeln erfüllender als den Kriegsruf. Soldat zu sein, war damals ein ständischer Beruf – er übte den entgegengesetzten Beruf aus, er war Diener der Kirche, die zum Frieden führt und zur Güte. Aber diese Pfarrerstochter Gustave Fecht, ein hochgewachsenes, blondes Mädel mit blauen Augen, die wie Sterne leuchteten, schalkhaft blitzen, aber auch fast männlich scharf sein konnten, die wollte wissen, wie es stand mit den politischen Dingen, die deutsches Schicksal schufen. Hebel schrieb ihr in knappen Sätzen Bericht. Was er erlebt, was ihn bewegt, die vielen Abschnitte seines Lebens werden getreulich der "Jungfer Gustave" mitgeteilt. Es ist bezeichnend für das Charakterbild Hebels, daß er sich immer wieder um die kleine Landpfarre nahezu betrogen fühlt, die er sich von Anfang an inmitten seines heimatlichen Raumes freundlich gelassen ruhend erträumt hatte. Gustave mochte auch im stillen ihre Hoffnungen an ein Pfarrhaus gehängt haben. Sie hätte zwar in Karlsruhe durch ihre stolze Haltung und ihre Gewandtheit neben Hebel wohl bestehen können; aber als Hebel Hofdiakon, dann Professor wurde und einen Haushalt hätte bestreiten können, war er nicht mehr heiratslustig, es hatte zu lange gedauert, bis er sich nicht mehr mit Privatstunden neben dem Dienst abplagen mußte, um schuldenfrei mit seinem Einkommen durchzuhalten. Außerdem war Gustave nicht ohne Bitterkeit durch die lange, heimlich bange Wartenszeit gegangen. Ihr Wesen, dessen Grundzug von ungewöhnlicher Willenskraft zeugte, setzte neben den ihr sonst eigenen Humor immer häufiger das "Sauerampfergesicht", wie Hebel ihre ärgerliche Miene nannte. Es schien Hebel, der natürlich seine Freiheiten und Sonderlichkeiten liebgewonnen hatte, besser, die Freundschaft mit ihr zu wahren, als womöglich eine für beide Teile enttäuschende Ehe zu wagen. Aus den Briefen an Gustave, wie überhaupt aus dem regen Briefwechsel mit Freunden, auch mit der Straßburger Familie Haufe, schaut das lebendige Leben des Dichters klar heraus. Es ist kein hinstürmendes Schicksalsgedicht, selbst ganz nahe Ereignisse, wie der Aufstieg Napoleons, die Befreiungsschlacht bei Leipzig, fanden in Hebel beinahe beschaulich, wie durch ein zwar scharfes, aber weit vom Schuß aufgestelltes Fernrohr gesehen, ihren Bericht. Die Zeit war seelisch auf das Beschauliche gerichtet, auf die gelassene Sinndeutung. Ein seltsamer Gegen- [396] satz zu den sich überstürzenden Vorfällen im mitteleuropäischen Raum! Ehe Napoleon auftrat, von dem viele Deutsche, verwirrt und zermürbt von Streitereien und Sonderbündeleien, in großem Irrtum glaubten, er sorge endlich für Frieden nach so viel Blutvergießen, waren schon Leute am Werk, das Reich neu zu festigen. Sie wollten vom Geistigen her die auseinanderstrebenden Kräfte binden. Zu ihnen gehörte der Markgraf Karl Friedrich als eine Führernatur, von reinstem Idealismus getrieben, dem er freilich durch Taten den unfruchtbaren Überschwang nahm. Er wollte vor allem in seinem Lande, das viele Zeugen hoher Kultur seit Jahrhunderten in seinem landschaftlich besonders begnadeten oberrheinischen Raum trotz zahlloser Kriege sich bewahrt hatte, eine große deutsche Akademie gründen, wo durch berühmte Lehrer, wie Herder und Klopstock und andere, eine Schicht deutscher Jugend aufgezogen würde, die später das Reich mit ihrer tiefen, wesenhaft nationalen Gemeinschaftsbildung durchsetzen sollte. Es waren Ideen, die wir erst heute sich verwirklichen sehen. Karl Friedrich fand damals nicht viel Gefolgschaft. Was er plante, wirkte sich daher nur in seinem kleinen Lande aus. Da Hebel das volle Vertrauen des Fürsten besaß – der Fürst besuchte alle Predigten des tüchtigen geistlichen Lehrers –, wurde er sicherlich auch tief in die nationalpolitischen Pläne und Gedanken des großzügigen Mannes eingeweiht. Er hat an ihnen nicht lauten Anteil genommen, aber in seinem Erzählwerk blitzt manches bessere Wissen auf, manche überlegene Fühlungnahme mit den stürmischen Zeitläuften. Eine leidenschaftliche Kämpfernatur war Hebel nie. Er liebte das Vagabundische, das ihm auf den Landstraßen, auf den Wanderfahrten und Reisen begegnete, aber er selber hat innere Unruhe und auch Leichtsinn, die ihn zuweilen umtrieben und in Versuchung brachten, stets auf die ungefährlichste Weise überwinden können durch sein Verlangen nach häuslicher Wärme und dem Gleichmaß der täglichen Pflichten. Das fränkische und das alemannische Erbteil spielten Fernweh und Heimweh harmonisch gegeneinander aus. Bestätigt wird sein Charakterbild von ihm selber in einem Brief an Gustave. Er war durch Weinbrenner mit einem Maler aus Schweden bekannt geworden, der die Schädellehre in Paris von Gall gelernt hatte, die damals überall ihre Anhänger fand. Hebel schreibt nicht ohne spöttischen Unterton am 16. Mai 1812: " Er fand an meinem Kopf Scharfsinn, Schlauheit, Bedächtigkeit, Religion, Poesie. Es schien mir, daß es mit seiner Kunst nicht weit her sei. Aber auch am nämlichen Abend gestand mir Weinbrenner in seiner Unschuld und Einfalt, daß ihm dieser Mann mehrere Köpfe von hiesigen Personen, die er nie gesehen hatte, nach einer bloßen Schilderung, die er ihm von ihrem Charakter machte, richtig abgezeichnet habe, zum Beispiel meinen, und es war mir interessanter, darnach erfahren zu haben, was man in Karlsruhe von mir haltet, als was der Schädellehrer an mir findet." In der Nähe betrachtet, sind die Eigenschaften, die Hebel da aufgezeichnet hat, erbbäuerliche Eigenschaften, wie sie sich im Markgräfler, d. h. im alemannischen [397] Bauern, vereinigen zu seiner wesentlichen Prägung. Hebel selber fühlte sich stets tiefer mit dem alemannischen Wesen verbunden, das den Raum seiner Jugendzeit ausfüllte, als der fränkischen Art, die er in seinem Mannesleben um sich hatte in Karlsruhe. Es gefiel ihm wohl in der Stadt, an die gesellschaftlichen Umstände, die Zirkel, zu denen ihn Freundschaft und reger geistiger Austausch zog, gewöhnte er sich gern; dennoch schlug er nicht Wurzel. Als man ihm in Freiburg die lutherische Pfarrstelle anbot, machte das oberländische Herz einen freudigen Gump und entschied sich für Freiburg; aber der Landesherr sah leutselig auf den schon mit der Seele entwischten geistlichen Professor, und Hebel blieb, wo er war. Er wird Lyzeumsdirektor im Jahre 1808, und 1818 steigt er zur höchsten Würde seiner Kirche auf, er wird Prälat. Karlsruhe, die gute Stadt, war inzwischen Hauptstadt des Landes Baden geworden, das vom Bodensee bis zum Main reichte, ein langgestrecktes Reich, das Kernstück des oberrheinischen alten Kulturkreises mit den pfälzischen Städten Heidelberg und Mannheim. Ein reiches Stück fränkischer Kulturlandschaft bis Wertheim und Tauberbischofsheim gehörte nun auch zum badischen Hoheitsgebiet. Aus dem Markgrafen war ein Großherzog geworden. Und Baden wurde Rheinbundstaat, dem Korsen hörig. Bittere Zeit für deutsche Herzen! Doch mußte der Mund verschlossen bleiben, es hing viel Schicksal von unbedachten Äußerungen ab. Endlich, nach Napoleons Untergang, brachen die deutschen Herzen wie Blüten auf; weil es dem Lande verhältnismäßig gut ging – es sei denn Söhne und Väter mußten in welschem Sold davonziehen und ihr Leben lassen –, empfand mancher die bedrückende Scham über die Fremdherrschaft erst, als die Glocken die Befreiung und die neue Einigkeit im Reiche verkündeten. Fast scheint es, als sei dies auch Hebel so gegangen, der seinen Amtsgeschäften sich so eifrig und mit schöpferischem Wollen hingab, daß er über sie hinaus nur noch das Bedürfnis nach einigen beschaulichen Ruhestunden im Kaffeehaus Drechsler bei einem Freundeskreis hatte, woselbst eine Zeitlang die Mode des Rätselmachens und ‑lösens, bis zur geistigen Überspitzung gesteigert, auch Hebel beherrscht hatte. Viele seiner Rätsel und Scharaden werden heute noch im Volke aufgegeben, ohne daß es weiß, von wem sie stammen. Diese Entspannung im frohen Kreise, der nichts mit spießbürgerlicher Stammtischrunde gemein hatte – dem wäre Hebel entflohen –, konnte er nicht missen. Er liebte dazu den Becherlupf mit dem klaren Weine der Heimat, der den Geist anregt und das Gemüt erhellt. Er hielt für gewöhnlich Maß, aber er gesteht der gestrengen, heimlich schalkhaften Jungfer Gustave, daß auch einmal eine Nacht darauf ging und der Leichtsinn über ihn kam. Das Weltkind in Hebel feiert überhaupt gern fröhliche Urständ. Er reist nach
In den Jahren 1799 bis 1802 schrieb Hebel, damals Professor und vielbelasteter Lehrer, in einem merkwürdigen Zustand wunderbarer Begnadung seine alemannischen Gedichte. Müde und mißmutig, so geht es wie eine Legende über den göttlichen Anstoß zu den Dichtungen durch alle Bücher über Hebel, müde und mißmutig hatte der Vielbelastete sich vom Dienst freigemacht und war, wie schon oft, in den Schwarzwald hineingewandert auf gemächlich schreitenden Apostelfüßen, bescheiden oft neben Bauersfrauen, Handwerksburschen oder Dorfschulkindern her, und war, je näher er seinem Ziele, dem Gasthaus auf dem Dobel bei Herrenalb, kam, um so heiterer geworden. Schließlich, seine Pfeife rauchend, "Tabaktrinken" genannt, lehnte er behaglich sinnend zum Stubenfenster hinaus. Da schlugen auf einmal seltsame Laute an sein Ohr. Das Ch, das harte, kannte er doch! Wenn's keine Spanier oder Holländer waren, so mußten das Alemannen sein, die sich da unter seinem Fenster etwas zuriefen. Es waren Schweizer aus der guten Stadt Bern, wie sich später herausstellte. Das heimelte, "bi Gott", den Oberländer im Unterland "chaibemäßig" an, und leise begann das "ewig mutternde und bruttelnde Heimweh" in Reimen zu reden, ja da war es wie in dem großen kosmischen Frühlingsgedicht "Hephata, tu dich auf", das er als eines der letzten guten alemannischen Gedichte schrieb: ein heimlich geborgener Schatz begann sich an den Tag zu schaffen. Der Dichterborn sprudelte. Die großen Idyllen entstanden, oft in die Form der geliebten klassischen Dichtung gegossen, was dieser Mundart, so seltsam das klingt für eine bäuerliche Sprache, überraschend gemäß schien. Sie hatten zum Stoff Geschehnisse aus dem Volksleben der Heimat, aus dem Bauern-, Liebes- und Soldatenleben, aus dem Walten der Natur, die Hebel ja besonders im kleinen Weben der Käfer, Schmetterlinge, Gräser, Blumen tief erschaute, da er ein liebender Naturforscher war. Werden und Vergehen, Blühen und Wachsen, der ewige Wechsel zwischen Gegenwart und Vergänglichkeit wird in volksvertrauten Bildern und Sinnbildern vom Dichter dargestellt. Die Mundart der Alemannen fügte sich eigentümlich wesenhaft, wie von altem Zauber und Wissen durchgeistert, dem sinnend singenden Mund des Begnadeten. Das mittelalterliche Deutsch ist im Alemannischen uns aufbewahrt geblieben. Es hat die letzte Lautverschiebung nicht mitgemacht, daher ist ihr Ton so würdig wie eine Überlieferung, die noch im Gefühl blieb, daher ist ihr Ernst so feierlich, weil diese Sprache nicht nur über die Zunge springt, sondern im Geiste blieb und nicht dem rauhen Witze diente, wie dies mit vielem bäuerlichen Volksbesitz geschah. Es war für Hebel ein Wagnis, so zu dichten. Er hatte aber nicht das Gefühl, Besonderes dabei geleistet [399] zu haben. Dies entspricht seinem fast kindlich sauberen Wesen. Er sagt scheinbar einfach die Dinge hin, die er zu Reimen paart. Scheinbar einfach. Es gerät ihm so, er hat aber Anregungen aus seinen lateinischen und griechischen Klassikern erfahren. Wie er diese verwertet, ist einzigartig in der Geschichte der deutschen Dichtung, weil sie sich in ihm unversehens in einem der wunderbarsten schöpferischen Akte umwandeln zu dem, was Nähe um den deutschen Menschen ist, Aussage Gottes in die Seele hinein durch seine lebendigen Wesen und ihre Taten! Hebel war ein Schriftgelehrter, ein deutscher Schulmeister aus innerer Berufung, ein Kanzelprediger, bei dem die schläfrigsten Gläubigen wach blieben, ein Lebenskünstler dazu, dem es durchaus nicht an dem gewissen großen Zug künstlerischer Menschen fehlte, der Zuneigung zum Außerordentlichen. Dies alles gehört zu den Sachen "ehne dra", zu seinem Denken hinter dem Gesagten, dem Wissen um Ursache und Wirkung des Geschehens, um Gesetz und Wahrheit. Trotzdem blieb seine Dichtung so volksnah, so ursprünglich, wie wir dies kaum mehr bei einer deutschen Dichtung erlebten. Jedes Schulkind kennt die Gedichte vom "Spinnlein", vom "Mann im Mond", vom "Knaben im Erdbeerschlag", vom "Wegweiser". Das ganze Menschenleben in seiner Tragik und seiner Schicksäligkeit fand erschütternde und unvergeßliche Darstellung in den großgefügten Dichtungen "Die Vergänglichkeit", "Der Wächter um Mitternacht" und vorab, neben dem tiefen, alle Schauer des Todes und alle Wonnen des Lebens umfassenden Gedicht "Vergänglichkeit", im wundersamsten seiner erzählenden Gedichte, der "Wiese". Da ist nichts undeutlich und geschwätzig, nichts erzwungen. Wie er dichtet, so redet, handelt, lacht, liebt, sinnt, betet, leidet, leibt und lebt das Volk. Und wie er es vor die Türe führt zu den ewigen Geheimnissen von Tod und Seligkeit nach dem Erdensein, vor die Türe, hinter der dann die "Sache ehne dra" beginnen, von denen er in dem Gedicht "Der Wegweiser" spricht, das hat viele große Zeitgenossen Hebels erschüttert. Auch Goethe, der sonst nicht so freigebig war im Lob anderer Dichter, war gepackt von der Naturkraft, die ihn aus Hebels alemannischen Gedichten ansprach. Für das geordnete, zuchtvoll gestaltende Genie hatte übrigens die große geistige Sonne Weimars stets achtungsvolle Teilnahme geäußert. Hebel, durch die Schule klassischer Dichtung gegangen, liebte selber die zuchtvolle Form. Er faßte die Quelle, die in ihm sprudelte, in schöne, äußerlich gelassen scheinende Form. Deshalb blieb sein Dichten hohe Kunst, weil es einfach, doch festlich in die Form gekleidet ist wie eine österliche Kirchgängerin in ihre Tracht. Hebel hat die große Wirkung seiner Gedichte nicht erwartet. Er mußte mit Staunen erleben, daß vor seinem Schlafraum im Hause des Dekans Nüßlin zu Emmendingen, in der Stadt, wo auch Goethes einzige Schwester Cornelia als Frau des hohen Beamten Schlosser gelebt hatte, der Mann mit Laterne und Spieß sein alemannisches Wächterlied zu singen begann. Hebel lag schlaflos morgens um zwei Uhr. Er ging damals gerade zu Rate mit sich,
"Looset, was i euch will sage! Komponisten, Sänger und Sängerinnen ließen es sich nicht nehmen, die Hebelschen Gedichte zu vertonen und zu singen, Maler, wie Ludwig Richter, regten sie zu Bildern an. Sie wurden überraschend schnell im besten Sinne volkstümlich. Die Mundart machte zwar in manchen Gauen Deutschlands Schwierigkeiten, aber sie war nie so unüberwindlich, wie man befürchtete. Es war die Eigenart, die Sinnenklarheit der Stoffe, die auch mundartfremde Leser und Hörer in ihren Bann schlug. Er hat die Schöpfung, das Weltbild, die Sinnbilder und Gleichnisse des Lebens einfach und unmittelbar verdichtet. Dies gilt auch für seine Kalendergeschichten in schriftdeutscher Sprache, die er in seinem Volkskalender, dem "Rheinischen Hausfreund", herausgab. Dieser Kalender war am Einschlafen gewesen. Hebel hat ihm – kaum zu treuen Händen –, ohne es zu merken, sofort ein anderes Gesicht gegeben, das Volksgesicht. Wie köstlich ging uns doch die Geschichte vom "Kannitverstan" ein, die ödeste Schulstube in die reiche bunte Fremde der Stadt Amsterdam wie im Märchen verwandelnd, den bescheidenen Handwerksburschen aus Tuttlingen mitten drinnen! Wie köstlich blieb sie noch, wenn der reife Mann sie wieder unter die Augen bekam, wenn ihn das Leben den tieferen Sinn der einfachen, so schön erzählten Geschichte gelehrt hatte. Wie unvergänglich bleiben die Geschichten "Das wohlfeile Mittagessen", "Der seltsame Spazierritt", "Untreue schlägt den eigenen Herrn", "Das seltsame Rezept", "Der Barbierjunge von Segringen", "Drei Wünsche", "Unverhofftes Wiedersehn" und die vielen anderen Anekdoten aus dem Soldatenleben, aus dem Weltgeschehen, aus dem Sagen- und dem Sprichwörterreichtum des Volkes. Die fröhlichen, mit besonderem Behagen und Schmunzeln erzählten Spitzbubengeschichten von Zundelheiner und Zundelfrieder, ihren Kumpanen und ihren Opfern blättern ganz ungeniert eine Seite in Hebels Seele auf, die jeder steifwürdige Pfarrherr, falls sie sich bei ihm gezeigt, vernichtet haben würde. Beileibe nicht an die Öffentlichkeit damit! Hebel hebt sie harmlos zwinkernd mit dem von Fältchen umstrahlten Schalksauge unter die blanken Gesichter aller junger Springinsfelde und aller abgeklärten Weisheit. Nur dummen und engen Köpfen wandelt sich der übermütige Ton der Geschichten nicht in die erzieherische Mühelosigkeit des [401] begnadeten Seelenkenners. Wer diese, gerade diese Geschichten liebt, ist noch nie schlecht durch sie geworden, sondern gütig und freizügig, er ist ein Sozialist des Herzens geworden. Hebel hat mit Zundelheiner und Zundelfrieder durch das Waghalsige das Böse besiegt. Der geneigte Leser merkt etwas! Hebel schrieb auch hochdeutsche Gedichte, nur wenige zwar, meistens sind es Gedichte zu festlichen Anlässen, für Freunde, für seinen Kalender. Manche sind heute zum Volkslied geworden, wie das schöne gelassene Neujahrslied "Mit der Freude zieht der Schmerz" oder das Abendlied, wenn man aus dem Wirtshaus geht "Jetzt schwingen wir den Hut" oder das Musketierlied "Steh ich im Feld".
[402] Du
hesch as Wälderbüebli Beeri gunne
Verzellsch e Gschicht, so lächelts Läben
aim,
So lang ne Muul no: Mueder! sage cha,
Du ziehsch vom Volch, vom Volch di diesen
Ode Das Leben erfüllt sich Hebel mit Ehre und Freundschaft. Sie, die von seinen Gedichten und Geschichten begeistert sind, die großen Dichter und Denker wie Goethe und die Gebrüder Grimm, Jean Paul und viele andere, schreiben über ihn, sie verkünden ihn, sie besuchen ihn in Karlsruhe. Jean Paul ist von Hebel mit Genuß gelesen worden, aber als sie sich kennenlernen wollten in Heidelberg, verhinderte Mißgeschick ihr Zusammentreffen. Zuweilen ist Hebel des Ruhmes müde, er bringt zu viel Umstand in sein Leben, das er mehr und mehr dem Dienste widmet. Er schreibt auch biblische Geschichten, wie sie dem deutschen Gemütsleben und dem religiösen Gefühl des Kindes gemäß sein sollten. Schlicht und gut erzählte Volksgeschichten sind es, von frommer, lehrhafter Art. Sie erschienen der Geistlichkeit aber zu freizügig, zu willkürlich in der Verschiebung des Grundtones, der natürlich gänzlich vom fremdartigen Ausdruck wegstrebt zum Ton, der im deutschen Seelenraum heimisch ist. So betrachtet, ist der erste badische Prälat überhaupt zu wenig streng protestantisch, er bezieht zu unbekümmert die Natur, das Weltall, das Landschaftliche, das Völkische in seine religiöse Weltanschauung mit ein. Das ist seine großräumige Geisteshaltung. Enge, so sehr er sich bei der Betrachtung der ihm zugewachsenen Nähe verweilt, Enge herrscht nie um ihn. Er weiß, daß es Scheeläugige gibt, denen er es nie recht machen wird, das beunruhigt ihn nicht. Er überlächelt sie. Er bleibt ganz rein von Bitternis. Er wird zwar zuweilen von Schwermut gepackt, als Freunde von ihm wegsterben. Er hat Stuben, deren Wände aus Büchern bestehen, meist theologischer und naturforschender Wissenschaft, den alten Klassikern und einigen deutschen Dichtern zugehörig. Er besitzt Tiere, einmal eine Katze, einen Stieglitz, auch eine zahme Eule; aber er hat sonst niemand um sich, der ihm verwandt ist durch Liebe oder im Blute. So fühlt er sich zuweilen sehr einsam. [403] Sein Herz hat für manche Frau gesprochen, er hat sich ganz ernsthaft verlieben können ein paarmal. Es gab zum Beispiel "Actricen", Schauspielerinnen, die er als eifriger Theaterbesucher von der Ferne zu lieben glaubte. Frau Hendel-Schütz, von der Goethe sagt, sie sei ein "lieber, unvergleichlicher Proteus", weil ihre Kunst der Verwandlung einzig war, hat ihm tiefen Eindruck gemacht, aber er verrät es nicht, wie tief. Diese teils schmerzlichen, teils enttäuschenden Erlebnisse verschließt
Er altert körperlich früher als sein Gefühl, wird von mancherlei Bresten gequält, er war nie ein Riese. Auf einer Prüfungsreise befällt ihn schweres Leiden, das sich schon lange festgesetzt hatte. Er kann sich noch zu seinem Freund, dem Gartenbaudirektor Zeyher in Schwetzingen, schleppen, legt sich dort nieder und stirbt am 22. September 1826. Er starb im fränkischen Land und hatte seine alemannische Heimat lange nicht mehr gesehen. Sie begruben ihn in Schwetzingen statt in Hausen. Geboren wurde er im Stammesgebiet der Mutter, zu Basel, zur Ruhe gebettet im Stammesraum seines Vaters. Das sieht aus wie ein deutsames Geschehen. Der Liebesgemeinschaft einer bäuerlichen Magd und eines bäuerlichen Soldaten, die sich im Geiste und im stolzen Wesen ergänzten, war ein wunderbares, zeitlos lebendes Herz – das Herz des deutschen Dichters Johann Peter Hebel entsprungen.
 |