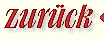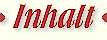|
 Um die Wiedergesundung Vierzig Jahre Erfahrung mit politischer Justiz liegen nun hinter mir, Erfahrung in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Regimen, im Krieg und im Frieden. Am Ende aber steht die Erkenntnis, daß die politische Justiz überall Formen angenommen hat, die nicht mehr zu verantworten sind und uns einer Katastrophe entgegentreiben, wenn wir uns nicht in letzter Stunde eines Besseren besinnen. Das ist die Krankheit unserer Zeit, die seit 1918 von Krise zu Krise fortschritt, in den Jahren von 1925 bis 1930 in ein erstes, von 1933 bis 1935 in ein zweites akutes Stadium eintrat und dann von 1942 bis 1945 und von 1945 bis 1949 uns in ein wahres Chaos führte. Seitdem ist vieles besser geworden. Das Jahr 1949 bedeutet eine erste Zäsur in unserer Nachkriegsgeschichte. Es brachte uns das Grundgesetz und die Bundesrepublik. Das war der Anfang einer neuen rechtsstaatlichen Entwicklung. Aber es war doch erst ein Anfang! Wir leben heute in einer Zeit des Übergangs, zwischen Krieg und Frieden, aber auch am Rande von Recht und Willkür.39 Wir ringen um die Wiedererlangung unserer Souveränität, um Freiheit, Einheit und Recht sowie um den Aufbau eines neuen Staates in freiheitlichem, demokratischem Geiste, der sich harmonisch in eine höhere europäische, ja Weltordnung einfügen soll. Es ist der Weg zurück, den wir finden müssen, der Weg zur Wiedergesundung und zur inneren und äußeren Befriedung. Dieser Weg zurück aber ist schwer. Er muß sich in Etappen vollziehen. Wir dürfen nicht ungeduldig werden. Wer wollte den Männern, die heute die Verantwortung für die Wiederaufrichtung von Volk und Staat tragen, ihre Aufgabe erschweren? Wir haben noch keinen Friedensvertrag, noch keine deutsche Einheit. Das "Vertragswerk", das der Bundesrepublik eine größere Freiheit bringen soll, ist noch nicht in Kraft. Wir leben noch unter Besatzungsstatut. Aber auch das "Vertragswerk" ist ja nur eine Etappe auf dem Wege zur vollen Gleichberechtigung. [Anm. d. Scriptorium: was hätte Prof. Grimm wohl gesagt, wenn er geahnt hätte, daß Deutschland 50 Jahre nach dem Datum dieses Schreibens noch immer keinen Friedensvertrag, noch immer keine wirkliche Einheit und noch immer keine volle Gleichberechtigung haben wird!] Wir stehen mitten in einer Entwicklung, die uns aus dem Zustand voller Entmachtung und voller Entrechtung einem neuen Leben entgegenführen soll. Wir wachsen in den Frieden hinein, in den Rechtszustand, der uns den anderen Ländern der europäischen Ordnung wieder ebenbürtig an die Seite stellen soll. Das ist ein Vorgang, wie man ihn in Frankreich eine "création continue", eine fortgesetzte Schöpfung, nennt, eine Entwicklung, die man sorgsam pflegen und beobachten muß. Diese Entwicklung schreitet organisch voran, sie wächst im Bewußtsein der Völker. Es bildet sich neues Recht. Wir müssen dessen nur gewahr werden. Die normative Kraft des Faktischen ist eine rechtsgestaltende Macht. Wir dürfen diese Entwicklung nicht durch Unüberlegtheit oder unnötige Rechthaberei stören. Die Probleme sind in vielem so ähnlich wie nach 1918, aber wir befinden uns nach dem totalen Zusammenbruch in einer anderen Lage wie damals. Das bedeutet jedoch nicht, daß wir nicht für unser Recht eintreten sollten. Der Kampf ums Recht mit legalen Mitteln, in fairer Form ausgetragen, ist die einzige Form, die Völker und Menschen wieder zusammenzubringen. Eine Vogelstraußpolitik ist noch niemals von Nutzen gewesen.
Um die Wiedergesundung müssen wir kämpfen. Daran muß jeder mitwirken,
jeder an seinem Platz. Prüfen wir also, woran es liegt, daß wir seit 1918 in eine
Politisierung der Justiz geraten sind, die alle Völker unseres Kulturkreises befallen hat.
Fragen wir uns, was des Übels Kern ist und welche Mittel wir ergreifen müssen, um
der Erkrankung Herr zu werden.
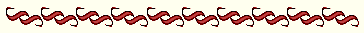 . Des Übels Kern Betrachtet man die politische Justiz unserer Zeit als eine Krankheitserscheinung, dann muß man wie ein Arzt verfahren, eine Diagnose stellen und eine Therapie suchen. Das ist schwer, weil die wenigsten sich heute getrauen, dem Übel der politischen Justiz auf den Grund zu gehen und das Kind bei dem richtigen Namen zu nennen. Bezeichnend ist die Feststellung von Dombois (Anm. 2, S. 4), der von dieser Erkrankung spricht und sagt, daß "die selbst bedrohten Ärzte sich sogar scheuen, auch nur eine Diagnose zu stellen". Diese Scheu müssen wir überwinden. Wir müssen offen aussprechen, um was es da geht. Alles Drumherumreden, jede Beschönigung und allgemein gehaltene Beteuerung rechtsstaatlicher Grundsätze, die an dem Kernpunkt der Dinge vorbeigehen, sind zwecklos. Eine klare Erörterung des Problems ist Pflicht gegenüber Volk und Staat, aber auch gegenüber den anderen. Sie kann um so leidenschaftsloser durchgeführt werden, je mehr wir anerkennen, daß es sich um eine Allgemeinerscheinung handelt, für die wir alle verantwortlich sind, je mehr also das Prestige ausgeschaltet wird. Wie war es möglich, so habe ich mich oft gefragt, daß eine so hohe Rechtspflege, wie sie bis 1918 in allen europäischen Staaten entwickelt war, solche Zerfallserscheinungen aufweisen konnte? Was ist der letzte Grund, der diese Entwicklung zuließ? Da scheint es mir, daß der Kernpunkt alles Übels, soweit das deutsche Recht in Frage kommt, in der Stellung der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung im politischen Prozeß, in dem sogenannten Weisungsrecht, der Handhabung des Legalitätsprinzips in politischen Sachen und der modernem Rechtsdenken nicht mehr entsprechenden Art, wie bei uns die Voruntersuchung und die Untersuchungshaft geführt wird, zu suchen ist. Man hat die Staatsanwaltschaft früher die objektivste Behörde genannt. Sie war es auch, und ist es noch auf dem Gebiete des gemeinen Strafrechts. Sie ist es nicht, wenn es um politische Justiz geht. Denn sie ist eine politische Behörde. Weil sie aber eine politische Behörde ist, weil sie dem Weisungsrecht der parteipolitisch beherrschten Justizverwaltung unterliegt, ist sie im Bereich des Politischen das Werkzeug der Exekutive, durch das diese die rechtsprechende Gewalt im Sinne der Staatsräson, d. h. ihres politischen Interesses, beherrscht. Das bedeutet, daß das Legalitätsprinzip, das in unserem Strafprozeß gilt, in politischen Prozessen praktisch durch eine Art Opportunitätsprinzip abgelöst wird. Dabei gebrauche ich das Wort Opportunitätsprinzip allerdings in einem erweiterten Sinne. Ich meine damit, daß in politischen Angelegenheiten die Staatsanwaltschaften sehr oft eine strafrechtliche Verfolgung nicht dann einleiten, wenn sie im Sinne des § 152 Strafprozeßordnung nach dem Gesetz, der lex ipsa, zum Einschreiten verpflichtet sind, sondern dann, wenn ein politisches Interesse die Einleitung eines Strafverfahrens opportun erscheinen läßt. Die Politisierung der Justiz auf diesem Wege wird dadurch erleichtert, daß das Ermessen darüber, ob "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" für das Vorliegen einer strafbaren Handlung im Sinne des § 152 Strafprozeßordnung vorliegen, unendlich weit ist. Man kann bei Beurteilung von Indizien und aller sonstigen Umstände eines objektiven und subjektiven Tatbestandes so sehr verschiedener Ansicht sein, daß es schwer, wenn nicht unmöglich ist, der jeweils entscheidenden Dienststelle eine Pflichtverletzung oder auch nur einen Ermessensmißbrauch vorzuwerfen, wenn sie so oder so entscheidet. Politische Justiz in unzulässigem Sinne liegt aber schon immer dann vor, wenn die betreffende Strafverfolgungsbehörde sich bei ihrer Entscheidung, ob sie ein Strafverfahren eröffnen will oder nicht, nicht nur von sachlichem, d. h. strafrechtlichen, Erwägungen leiten läßt, sondern politische Gründe, Motive der Staatsräson, bestimmend sind und der strafrechtliche Tatbestand, wenn er sich auch zur Not konstruieren läßt, in Wirklichkeit doch nur zum Schein geltend gemacht, "vorgeschoben", oder "unterschoben" wird, wie Dombois (Anm. 2, S. 7, 8, 9) sagt, d. h. wenn der strafrechtliche Tatbestand nur noch die "Prozeßform" ist, in der sich eine politische Verfolgung vollzieht (Dombois Anm. 2, S. 6), wenn also ein "Formenmißbrauch" vorliegt, wie es Dombois (Anm. 2, S. 9) nennt. Man könnte auch von Pseudostrafrecht sprechen, wie Ehlers (Anm. 2, S. 30) dies mit Bezug auf die Entnazifizierung tut. Deshalb müßte die Staatsanwaltschaft, die bei Einleitung des Strafverfahrens ja schon eine quasi-richterliche Entscheidung trifft, bei dieser Entscheidung genau so unabhängig sein wie ein Richter. Ein Weisungsrecht darf es da nicht geben. Auch der Staatsanwalt als Organ der Rechtspflege darf nur seinem Gewissen und dem Gesetz für seine Entscheidung verantwortlich sein. In der Zeitung Die Welt vom 29. April 1953 hat Dr. Manfred Mielke unter dem Titel: "Relikt der Kabinettsjustiz. Ankläger auf Befehl" einen bemerkenswerten Artikel veröffentlicht, in dem auch er die Ansicht vertritt, daß zum Rechtsstaat die Unabhängigkeit der Staatsanwälte gehöre. Er wendet sich dagegen, daß die Staatsanwaltschaft an die Weisungen der Justizverwaltung gebunden ist und damit "der starke Arm der Exekutive geworden und geblieben ist". Er sieht darin, indem er sich auf Professor Bader, den früheren Freiburger Generalstaatsanwalt und jetzigen Strafrechtslehrer an der Universität Mainz, beruft, eine "Gefahrenquelle für den Aufbau und Bestand des gegenwärtigen Rechtsstaates". Er bemängelt es, daß das "parteipolitisch geführte Justizministerium die Staatsanwaltschaft zu allen Amtshandlungen klar anweisen kann, so daß sie als Organ der unabhängigen Rechtspflege dem Befehl der Exekutive zu gehorchen hat", also die "Ministerialbürokratie in der Praxis die Rechtspflege im Strafwesen beherrscht". "Erst die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft als Behörde", so sagt er, "befreit das Strafrecht von allen Einflüssen, die dem Dienst an der Gerechtigkeit zuwiderlaufen". Eine gründliche Reform unseres Strafprozesses ist daher nötig, damit wir endlich das "Relikt der Kabinettsjustiz" überwinden, von dem Mielke spricht. Das bedeutet also zunächst: Abschaffung des Weisungsrechtes. Das ist heute noch nötiger, als es im autoritären Staate war. Gewiß gibt es eine totale Politisierung der Justiz, wie wir sie unter Thierack erlebten, nur unter der Herrschaft des Zentralismus. In der Bundesrepublik aber, bei der die Justizhoheit wieder bei den Ländern liegt, sind die Möglichkeiten politischer Einflüsse auf dem Wege über das Weisungsrecht noch viel mannigfaltiger als im zentral gelenkten Staat. Diese Form der Politisierung der Justiz haben wir noch heute. Mit Recht sagt Sethe in der Frankfurter Allgemeinen vom 16. April 1953: "Mit steigender Sorge schauen alle verantwortungsbewußten Menschen auf die immer mehr fortschreitende Erschütterung des rechtsstaatlichen Denkens". Damit soll nicht gesagt sein, daß heute in allen deutschen Ländern und in allen Fällen die politischen Prozesse in unzulässiger Weise politisch gelenkt würden. Die Lage ist in den einzelnen Ländern verschieden. Das hängt jeweils von den Parteikonstellationen ab, die in den betreffenden Ländern vorherrschend sind. Das ist auch in weitem Umfang eine Persönlichkeitsfrage, sowohl bei den Stellen, die die Weisungen geben, wie bei denen, die sie empfangen. Das Weisungsrecht wird auch in der verschiedensten Weise ausgeübt, mehr oder weniger direkt. Nur selten werden generelle oder Einzelweisungen der Justizverwaltungen an die Staatsanwaltschaften so unmittelbar schriftlich gegeben, wie dies bei der Weisung des Preußischen Justizministeriums vom 19. April 1930 JMI 4929 geschehen ist. Es gibt ja auch Telefone und mündliche Anregungen. Die erste Reform muß also darin bestehen, daß das Weisungsrecht beseitigt und die Staatsanwaltschaft unabhängig gemacht wird. Die zweite Reform betrifft die Stellung des Verteidigers im staatsanwaltlichen Vorverfahren und in der Voruntersuchung. Es muß einmal offen ausgesprochen werden, daß die Stellung des Verteidigers im deutschen Strafprozeß, so wie er noch heute gehandhabt wird, nicht nur unzulänglich und unbefriedigend, sondern geradezu entmutigend ist. Es ist daher nur zu verständlich, daß es viele Rechtsanwälte grundsätzlich ablehnen, in Haftsachen als Verteidiger tätig zu werden, weil sie einfach die seelische Belastung nicht ertragen können, die ihnen diese niederdrückende Tätigkeit verursacht. Das Strafrecht ist aber die wichtigste Funktion unseres Rechtslebens überhaupt. Es sollten die besten Juristen Strafrichter, Staatsanwälte und Strafverteidiger sein! Ich glaube das sagen zu dürfen, da ich eigentlich aus dem Zivilrecht komme und ein passionierter Ziviljurist bin. So wie es aber heute ist, ist die Handhabung des Haftverfahrens in unserer Strafjustiz zu einer der delikatesten Einrichtungen unseres Staates geworden, da es nach meiner Überzeugung viel zu leicht ist, auch unbescholtene Staatsbürger in Haft zu bringen, aber sehr schwer, sie aus dieser Lage wieder zu befreien. Das wirkt sich besonders ungünstig bei politischen Verfahren aus. Die Verhaftungen sind bei politischen Verfahren das wichtige, nicht die Verurteilungen, die verhältnismäßig selten sind. Denn gewöhnlich werden in politischen Verfahren die Verhafteten nach einer mehr oder weniger langen Untersuchungshaft "mangels Beweises" entlassen. Sehr oft entsteht dann der Eindruck, daß die Freilassung erfolgt, wenn der politische Zweck des Verfahrens erreicht ist, daß aber eine öffentliche Hauptverhandlung, bei der die Unzulänglichkeit der vorliegenden Indizien allgemein offenbar würde, im Interesse der Staatsräson nicht opportun erscheint. Der Schaden, der durch die politische Untersuchungshaft, wie sie noch heute üblich ist, angerichtet wird, ist ungeheuerlich. Die Menschen, die davon betroffen werden, werden ihrer Freiheit beraubt, unter demütigenden Umständen in Untersuchungshaftanstalten eingesperrt, meist in Einzelhaft, unter Bedingungen, die nur robuste Naturen ohne dauernden körperlichen und seelischen Schaden überstehen. Dazu kommt der materielle Nachteil, der nicht nur sie, sondern auch ihre Angehörigen trifft, und oft geradezu existenzvernichtend ist. Verbitterung, Verzweiflung und Selbstmord sind die Folgen dieser bedauerlichen Zustände. Wie schwer aber ist es, eine Entschädigung für all diese Übel zu erlangen! Denn eine solche wird nur wegen "erwiesener Unschuld" gewährt. Ich habe es in meiner langen Praxis noch nicht ein einziges Mal erlebt, daß das Vorliegen dieser Bedingung anerkannt worden wäre. Erwiesene Unschuld? Wie leicht ist es doch, irgendein Moment subjektiver oder objektiver Art zu finden, das das Vorliegen erwiesener Unschuld ausschließt. Die zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortung der Organe des Staates, die die Untersuchungshaft verhängen, bietet auch keinen Schutz. Die Bestimmungen über Verbrechen und Vergehen im Amte, die immer nur krasse Fälle betreffen, finden in normalen Zeiten kaum Anwendung. Man hat sich dieser Bestimmungen erst erinnert, als ein politisches Interesse diese Verfolgungen wünschenswert erscheinen ließ. Das geschah aus Anlaß der externen und internen Kriegsverbrecherprozesse, bei denen es dann allerdings zu einer großen Zahl dieser Art strafrechtlicher Verfolgung gegen deutsche Beamte kam. Der Verteidiger ist das Organ der Rechtspflege, dem die hohe und verantwortungsvolle Aufgabe gestellt ist, an dem Schutz des loyalen Bürgers gegen fehlerhafte Handhabung der Strafjustiz durch die staatlichen Vertreter der Strafrechtspflege mitzuwirken. Unser Strafprozeß gibt ihm aber im Gegensatz zum französischen nicht sofort die Mittel, dieser Aufgabe genügen zu können. Das beruht darauf, daß unser Strafprozeß, jedenfalls im Vorverfahren, von mittelalterlichem Denken beherrscht wird. Ich habe es immer schon als bedenklich empfunden, wenn man mit besonderer Betonung, wie das vielfach geschieht, von dem "Strafanspruch" des Staates spricht, der nicht "gefährdet" werden darf. Als ob der Staat einen "Anspruch auf Bestrafung" seiner Bürger hätte, wie der Zivilgläubiger einen Anspruch auf Zahlung einer Geldsumme als Buße gegen seinen Schuldner. Als ob der Staat ein Interesse daran hätte, seine Gefängnisse zu füllen und möglichst viele seiner Bürger der Freiheit zu berauben. Der Staat hat die Pflicht, seine friedlichen Bürger vor Verbrechern, aber genau so auch sie selbst vor ungerechter Verfolgung zu schützen. Jeder, der dazu beiträgt, der Gerechtigkeit zu dienen, ob er kraft Amtes, wie der Rechtsanwalt, dazu berufen ist oder nicht, dient den Interessen des Staates. Die Bestimmungen über "Begünstigung" dürfen keinesfalls zu Fehlanschauungen verleiten. Die extremste Fehlanschauung, die allerdings bei dem achtungsvollen Verhältnis zwischen Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt, wie es in Deutschland besteht, selten anzutreffen ist, ist die, daß man in dem Verteidiger eine Art staatlich geduldeten Begünstiger sieht, dessen Tätigkeit man so sehr wie möglich einschränken und überwachen sollte. Daß es solche Auffassungen gibt, beweist der Fall Klefisch, den ich in der Hitlerzeit erlebt habe, bei dem man den Rechtsanwalt gleich kurzerhand mit verhaftet hat. Der Rechtsanwalt muß also, wenn wir einen Rechtsstaat aufrichten wollen, zu einem vollberechtigten Organ der Strafrechtspflege auch im Vorverfahren und der Voruntersuchung werden. Er muß gleichberechtigt neben Staatsanwalt und Richter stehen. Wir müssen zu einer kontradiktorischen Voruntersuchung gelangen. Wir müssen aus dem mittelalterlichen Geheimverfahren unserer Voruntersuchung heraus. Diese radikale Umgestaltung des ganzen Verteidigungswesens ist in Frankreich schon seit mehr als einem halben Jahrhundert vollzogen und praktisch erprobt. Das Gesetz vom 8. Dezember 1897 ist in Frankreich die Magna charta der Verteidigung geworden. Das Gesetz ist, als es eingeführt wurde, zwischen den Vertretern des Verteidigungsgedankens und den Verfechtern des staatlichen Strafanspruches im alten Sinne stark umstritten gewesen. Aber das liberale, kontradiktorische Prinzip hat über das autoritäre Prinzip gesiegt. Heute bestreitet in Frankreich niemand mehr, daß diese Rechtserneuerung richtig war. Wenn jemand in Frankreich verhaftet wird, muß er binnen 24 Stunden dem zuständigen Richter vorgeführt werden. Dieser hat ihn sofort zur Person zu vernehmen und ihm mitzuteilen, was ihm vorgeworfen wird. Er muß ihm dann sagen, daß er sich zur Sache nicht zu erklären braucht, und daß er das Recht hat, einen Verteidiger zu wählen oder sich bestellen zu lassen. Er kann sofort mit seinem Anwalt verkehren und darf von da ab nur noch in Gegenwart seines Verteidigers vernommen werden. Der Verteidiger ist 24 Stunden vor jeder Vernehmung des Angeschuldigten zu laden und hat am Vortage jeder Vernehmung Recht auf volle Akteneinsicht einschließlich aller Überführungsstücke. Wie aber ist es im deutschen Verfahren? Man wagt das kaum niederzuschreiben. Man kommt sich als Verteidiger nach deutschem Recht im Vorverfahren oft so vor, als ob man sich schuldig an einem Betruge mache - einem Betruge an dem Angeschuldigten. Der Angeschuldigte glaubt doch, einen Verteidiger zu haben. Er hat aber gar keinen Verteidiger. Er hat einen Betreuer, der ihn besuchen darf, oft auch nur in Gegenwart eines Richters, einen Seelsorger, der ihn stützt, der für ihn noch eine gewisse Verbindung mit der Außenwelt darstellt, einen Mann, auf den man allenfalls die Schweizer Berufsbezeichnung "Fürsprech" anwenden kann oder "Fürbitter", der für ihn etwas erbitten darf, aber keine klaren Rechte hat, die ihm eine wirksame Verteidigung ermöglichen. Einen Verteidiger gibt es in unserem Prozeß erst nach Abschluß der Voruntersuchung und Erhebung der Anklage. Vor diesem Zeitpunkt hat der Verteidiger kein erzwingbares Recht auf Akteneinsicht. Das Verfahren ist geheim. Der Angeschuldigte, der inhaftiert ist, ist von der Umwelt abgeschlossen. Das Verfahren wird beherrscht von dem Gesichtspunkt des Strafanspruches des Staates, der erst einmal nach allen Seiten gesichert werden muß, bevor die Verteidigung gehört wird. Was nützen da Haftbeschwerde und Haftprüfungstermine, wenn der Verteidiger die Haftbeschwerde mangels genügender Aktenkenntnis nicht begründen kann? Wenn wenigstens die Haftprüfungstermine noch öffentlich wären! Was aber die Öffentlichkeit anbelangt, so erlebt man in politischen Prozessen, daß oft völlig unzulässige und manchmal auch unrichtige Erklärungen von Organen der Exekutive gegeben werden, gegen die der Angeschuldigte und der Verteidiger sich nicht wehren können, wenn ihre Haltung nicht falsch ausgelegt werden soll. Der § 147 StPO. bestimmt: "Der Verteidiger ist nach dem Schluß der Voruntersuchung und, wenn eine solche nicht stattgefunden hat, nach Einreichung der Anklageschrift zur Einsicht der dem Gericht vorliegenden Akten befugt." Vor diesem Zeitpunkt, d. h. während der Voruntersuchung, "kann" ihm Akteneinsicht gestattet werden, soweit das "ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks geschehen kann". In Preußen war früher die praktische Übung die, daß dem Verteidiger in der Regel die Akteneinsicht gewährt werden sollte. Heute ist die Praxis, jedenfalls in politischen Sachen, umgekehrt. Der Verteidiger bekommt die volle Akteneinsicht meist nicht. Der Verteidiger befindet sich daher im deutschen Vorverfahren in einem unerträglichen Dilemma. Er ist, wenn er seinem Mandanten nützlich sein, d. h. ihn aus der Untersuchungshaft befreien will, auf das angewiesen, was man den "favor judicis" nennt, ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu Staatsanwalt und Untersuchungsrichter. Sein Mandant aber drängt ihn zu ständig neuen Schritten. So kommt es zu den Vertrauenskrisen zwischen dem Verteidiger und dem Angeschuldigten, dem sein Verteidiger zu weich, zu behutsam, zu diplomatisch vorgeht. Sehr oft verzichtet der Verteidiger auf Haftbeschwerde aus der Besorgnis heraus, daß diese Rechtsmittel, die kaum diesen Namen verdienen, doch nur eine Verzögerung des Verfahrens bedeuten. Besonders peinlich ist die Stellung des Verteidigers im Haftprüfungsverfahren. Er hat das Gefühl, daß Gericht und Staatsanwaltschaft, die die Akten kennen, Dinge wissen, die sie ihm vorenthalten. Er kommt dann entweder in die Gefahr, Behauptungen aufzustellen, die ihm später widerlegt werden können, oder Aufklärungen zu unterlassen, die möglich wären, wenn er die Beschuldigungen im einzelnen kennen würde. Die Rechtsstellung des Verteidigers im deutschen Strafprozeß muß also, soweit das Vorverfahren in Betracht kommt, völlig umgestaltet und der Rechtsstellung angepaßt werden, die der Verteidiger im französischen Verfahren innehat. Das erfordert allerdings einen hochstehenden Anwaltsstand, der strenge Selbstdisziplin üben muß. Aber sollte in Deutschland nicht möglich sein, was sich in Frankreich seit 50 Jahren bewährt hat? Ist der deutsche Rechtsanwalt weniger vertrauenswürdig als der französische? Außer diesen wichtigsten Reformen sind auch noch einige andere Maßnahmen zu erwägen, um dem Übel abzuhelfen. Ein Allheilmittel, die Politisierung der Justiz zu bekämpfen, gibt es allerdings nicht. Denn man kann die politische Justiz ja nicht abschaffen. Man kann nur ihre Auswüchse bekämpfen. Solche Maßnahmen sind: Scharfe Einhaltung des Verbotes der Verfolgung von Meinungsdelikten, Verbot der Sonderdezernate, Sondergerichte und Sondergesetze und Beschränkung der politischen Straftatbestände auf die Fälle von Hoch- und Landesverrat, die zur Verteidigung eines Rechtsstaates im Sinne einer demokratischen Rechtsordnung unbedingt notwendig sind. Es müßte auch dafür gesorgt werden, daß die öffentlichen Erklärungen der Organe der Exekutive über schwebende Verfahren, politische Polizeiaktionen, schlagartige Verhaftungswellen, Abhaltung von Pressekonferenzen usw. unterbleiben. Das alles bedeutet einen Eingriff der Exekutive in die Rechtsprechung, der geeignet ist, das Vertrauen in die staatliche Rechtspflege zu erschüttern. Die Auswirkungen dieses Verfahrens sind um so verhängnisvoller, als dadurch die öffentliche Meinung in einer bestimmten Richtung beeinflußt wird, ohne daß sich der Angeschuldigte gegen diese ihm nachteilige Meinungsbildung verteidigen kann.
Es bleibt schließlich zu prüfen, ob man nicht ein Gesetz gegen den Mißbrauch
der Justiz zu politischen Zwecken erlassen sollte, das allerdings vorsichtig gefaßt werden
müßte, damit dadurch nicht die strafrechtliche Verfolgung wirklicher Verbrecher
erschwert wird.
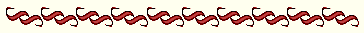 . Eine neue Gefahr Noch stehen wir mitten in der großen Krise, die uns der Zusammenbruch gebracht hat, noch haben wir die Folgen der politischen Justiz von gestern nicht überwunden, da droht der Entwicklung zum Rechtsstaat schon eine neue Gefahr. Sie kommt diesmal nicht in der Form der getarnten politischen Prozesse; sie erhebt sich bei den politischen Prozessen im engeren Sinne, die dem Schutz des neuen Staatswesens dienen sollen. Wieder gilt es, wie nach 1918, nach 1922, die richtige gesetzliche Form zu finden, wie der werdende Staat, der doch ein Rechtsstaat sein soll, vor seinen Feinden von rechts und links geschützt werden soll. Die verantwortlichen Staatsmänner stehen da vor einer Schwierigkeit, die schwer zu lösen ist. Die Strafrechtspflege darf nicht weich werden, gerade dann nicht, wenn der Staat noch nicht gefestigt ist. Aber sie muß gerecht sein. Sie muß auch geeignet sein, das Ziel, die Festigung des neuen Staates, zu erreichen. Deshalb ist besondere Vorsicht bei der Behandlung der politischen Prozesse geboten. Es gibt heute viele, die meinen, daß die Republik von Weimar zu weich gegen die Umsturzbestrebungen von links und rechts gewesen sei, daß man insbesondere das Republikschutzgesetz zu milde gehandhabt habe. Das ist zweifellos eine delikate Frage. Eine Demokratie darf ihre Grundsätze nicht verleugnen, aber auch nicht zulassen, daß ihre Gegner die demokratischen Einrichtungen durch deren Mißbrauch zu Fall bringen. Zwischen diesen beiden Extremen hat die Weimarer Republik den richtigen Weg nicht gefunden. Heute bemüht man sich, die Fehler der Weimarer Zeit zu vermeiden. Man hat auf den Erlaß eines besonderen Republikschutzgesetzes verzichtet und statt dessen in den zweiten Teil des Strafgesetzbuches einen besonderen Abschnitt eingefügt und darin die neuen Tatbestände der Staatsgefährdung und des Verfassungsverrates geschaffen, die in gewisser Hinsicht den Bestimmungen des Republikschutzgesetzes von 1922 vergleichbar sind. Man wird sich aber fragen müssen, ob die Formulierung der einzelnen Fälle in den §§ 88 bis 94 StGB besonders glücklich gewählt ist, oder ob man nicht hier den gleichen Fehler begangen hat, der sich schon im Republikschutzgesetz des Jahres 1922 so schädlich ausgewirkt hat: die viel zu weite und vage Fassung der strafbaren Handlungen. Besonders die §§ 88 und 90a StGB ermangeln der klaren und präzisen Tatbestände. Sie werden als Kautschukbestimmungen empfunden, die leicht zur Politisierung der Justiz mißbraucht werden können. Es wäre verfrüht, hierüber schon heute, wo die Rechtsprechung in dieser Materie beim Bundesgerichtshof erst in den ersten Anfängen steht, ein voreiliges Urteil zu fällen. Das Reichsgericht ist bei der Rechtsprechung zum Republikschutzgesetz immer sehr vorsichtig gewesen. Es ist zu hoffen, daß der Bundesgerichtshof dieser Tradition treu bleiben wird. Man hat also diesmal kein Sondergesetz geschaffen wie 1922; aber sind nicht die heutigen §§ 88 bis 94 StGB ihrer Natur nach Sondergesetze, die sich nur für eine bestimmte Zeit des Übergangs zu der neuen Staatsform rechtfertigen lassen? Das Republikschutzgesetz war nur ein Zeitgesetz. Es wird zu prüfen sein, ob nicht auch die §§ 88 bis 94 StGB nach einer gewissen Übergangszeit, wenn der neue Staat genügend gefestigt ist, einer nochmaligen Nachprüfung durch den Gesetzgeber unterzogen werden müssen. Das gilt auch von anderen wichtigen Bestimmungen, wie z. B. § 6 des Wirtschaftsstrafgesetzbuches, der wegen seiner viel zu unklar gehaltenen Fassung die Gefahr der Politisierung in sich birgt. Denn auch Wirtschaftsprozesse können der Politisierung der Justiz anheimfallen. Die beste Festigung der Staatsgewalt wird immer noch erreicht, wenn das gefühlsbetonte Vertrauensverhältnis zwischen Staatsführung und Staatsvolk wiederhergestellt wird, wie wir es im Bismarckreich hatten und seitdem nie wieder erlangen konnten. Die Unterlage hierzu aber ist das Vertrauen des Staatsbürgers zur Rechtspflege, die unabhängig von jedem politischen Einfluß für jedermann gleich sein muß. Alle diese Fragen sind in den Debatten des Bundestages und Bundesrates, bei denen die neuen Bestimmungen der §§ 88 ff. StGB über Staatsgefährdung beraten wurden, eingehend erörtert worden.40 Dieses durch das Strafrechtsänderungsgesetz vom 30. August 1951 eingeführte neue Recht ist auf die Initiative der SPD zurückzuführen, die am 15. Februar 1950 den Entwurf eines Gesetzes gegen die Feinde der Demokratie41 vorgelegt hat. Schon bei der ersten Erörterung dieses Gesetzes, das ein Sondergesetz sein sollte, wurde das Bedenken geäußert, daß es ein Maulkorbgesetz sein könnte und gerügt, daß es zu wenig substantiiert42 sei. Es wurde aber auch von dem Vertreter der SPD betont, daß damit keine Politisierung der Justiz43 gewünscht sei. Die Mehrzahl der Abgeordneten sprach sich gegen ein Sondergesetz und für den Einbau der Bestimmungen in das Strafgesetzbuch aus.43 Man wollte keinen Fremdkörper, keine Notverordnung, kein Ausnahmegesetz schaffen.44 Man wollte der Demokratie strafrechtlichen Schutz nach den Grundsätzen des Rechtsstaates gewähren.45 Man warnte auch vor der "unzulänglichen Formulierung einiger Tatbestände". Besonders der Abgeordnete Euler verlangte "scharf geschliffene Tatbestände", "klare Normen", Ausschaltung aller "Interpretationsschwierigkeiten". Sonst entstehe die Gefahr "richterlicher Willkür" oder "Rechtsunsicherheit", die sich sowohl im Rechtsbewußtsein des Volkes als auch in seinen politischen Reaktionen gegen die Demokratie richten würde, die geschützt werden sollte.46 Bei der Beratung im Bundesrat bezeichnete Dr. Josef Müller die Materie als stark umstritten, ja zweifelhaft.47 Bei den späteren Beratungen des dann vorgelegten Regierungsentwurfes und des Entwurfes des Rechtsausschusses des Bundestages, der schließlich angenommen wurde, wurde immer wieder betont, daß ein klarer Tatbestand, kein Gesinnungstatbestand48 normiert werden müsse. Auch der Abgeordnete Arndt mahnte namens der SPD zur "Vorsicht in der Wahl der strafrechtlichen Mittel" und warnte vor der uferlosen Bestimmung der Strafbarkeit wegen "Verfassungsstörung".49 Die neuen gesetzlichen Vorschriften sollen der Freiheit auf dem Wege des Rechts und dem Schutz des Staates dienen. Hinsichtlich des objektiven Tatbestandes darf aber der Gesetzgeber nur solche Tatbestände unter Strafe stellen, die vom Richter klar erkannt werden können.50
Besonders beachtlich war auch die Warnung des Abgeordneten Kiesinger, der die neuen
Bestimmungen nur einen "Notbehelf" nannte. Der wahre Schutz des Staates beruhe auf der
Achtung, Liebe und dem Vertrauen seiner Bürger. Jede strafrechtliche Inflation
müsse Bedenken erregen.51
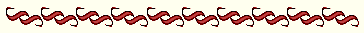 . Der immer noch nicht gezogene Schlußstrich Das Erschreckendste aber an der heutigen Lage ist, daß es bis jetzt, acht Jahre nach Beendigung des furchtbarsten Krieges, den die Menschheit erlebt hat, immer noch nicht gelungen ist, den Schlußstrich zu ziehen, der, seitdem die westliche Welt zu rechtsstaatlichem Denken gelangt ist, noch nach jedem Kriege die politische Justiz für alle Handlungen beendet hat, die irgendwie mit dem Kriege in ursächlichem Zusammenhang standen. Die sogenannte Kriegsverbrecherverfolgung, durch die man zum ersten Mal in Versailles mit einer jahrhundertealten Rechtsübung brach, ist die schlimmste Entartungserscheinung politischer Justiz. Sie ist es, die die gesamte Rechtsordnung unseres Kontinents bedroht. Als man nach 1870 die Forderung erhob, Napoleon III. und den Herzog von Gramont als die leichtfertigen Urheber des Krieges als Kriegsverbrecher unter Anklage zu stellen, hat Bismarck dies in einer Reichstagsrede mit der Begründung abgelehnt, die Ahndung solcher Taten müsse einer höheren Gerechtigkeit überlassen bleiben.52 Zu dieser Form politischer Justiz wegen schuldhafter Verursachung des Krieges hat sich dann seit 1945 der andere Typ der Kriegsverbrecherverfolgung, der "Greuelkomplex", gesellt, der, schon wegen der Masse der hieraus resultierenden Prozesse, die Menschheit nicht zur Ruhe kommen läßt. Dazukommt das beängstigende Problem der Unglücklichen, die man als "Unterseebootleute" bezeichnet, der Tausenden, die seit Jahren in Deutschland unter falschem Namen leben, in der ständigen Sorge, daß ihr wirklicher Personenstand entdeckt, und sie dann wegen irgendeines "Kriegsverbrechens" verfolgt werden könnten. Es sind Deutsche und Ausländer, Freunde der Deutschen, die auf den deutschen Sieg gebaut hatten. Sie finden keine Ruhe und keine bürgerliche Existenz, kein menschenwürdiges Dasein. Sie sind ständig dem Denunziantentum und der Erpressung ausgesetzt. Wie soll man ihnen anders helfen als durch Generalamnestie? Überall findet man heute die Opfer der politischen Justiz, Menschen, die verfolgt werden, weil sie den Gesetzen gehorsam waren, die zu ihrer Zeit für sie verbindlich waren. Man versucht, ihnen zu helfen. Die christlichen Kirchen beider Konfessionen, karitative Verbände und private Organisationen tun ihr Bestes. Die Opfer dieser politischen Justiz, die Frauen, die an der Tätigkeit ihrer Männer ganz unbeteiligt waren, die Kinder, sie wenden sich an die Behörden. Sie werden von einer Stelle zur anderen gewiesen. Sie wenden sich an die Rechtsanwälte. Man kann ihnen nicht helfen, wenn nicht einmal der Schlußstrich kommt, den die Menschheit ersehnt. Mit diesem furchtbaren Ballast der Vergangenheit müssen wir fertig werden. Das ist bis jetzt noch nach jedem Kriege so gewesen. Es ist die moralische und juristische Demobilmachung, die uns diesmal nicht zu gelingen scheint. Diese schlimmste Erkrankung unserer Zeit ist aber nur durch einen chirurgischen Eingriff zu überwinden, der manchem wehe tun mag, der aber nötig ist, wenn das Weiterleben des Gesamtorganismus diesen Eingriff fordert, der radikal und total sein muß, wenn er die totale und radikale Verwirrung beenden soll, in die uns die politische Justiz vor und nach 1945 gebracht hat. Den Mut zu diesem chirurgischen Eingriff haben wir bis heute noch nicht gefunden. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, daß es seit Hugo Grotius, dem Begründer des modernen Völkerrechts, und seit dem Westfälischen Frieden einen obersten Grundsatz des Völkerrechts gibt, den man das Tabula-rasa-Prinzip nennt und der besagt, daß nach jedem Krieg tabula rasa - reiner Tisch - gemacht werden, daß man einen Schlußstrich unter alle Vorgänge ziehen muß, die mit dem Kriege zusammenhängen, so schrecklich sie auch sein mögen, und daß das nur durch eine Generalamnestie53 möglich ist, die ein wesentlicher Bestandteil jedes Friedens ist. Der Mann auf der Straße hat dies längst erkannt. Er will von Kriegsverbrecherprozessen nichts mehr wissen. Er sagt: "Schluß damit!" und weiß gar nicht, daß er damit einen Rechtssatz ausspricht, der seit Jahrhunderten internationale Geltung hat. Dieser Grundsatz ist zum ersten Mal durch Heinrich IV. von Navarra, König von Frankreich, nach den blutigen französischen Religionskriegen im Edikt von Nantes am 13. April 1598 wie folgt ausgesprochen worden: "Das Gedächtnis aller Dinge, die auf der einen oder anderen Seite vorkamen seit dem Beginn des Monats März 1585 bis zu unserem Regierungsantritt, auch während der vorangegangenen Unruhen und bei deren Gelegenheit, soll ausgelöscht und begraben sein wie etwas, das nie geschah; und es ist weder für unsere Staatsanwälte noch für irgendwelche öffentlichen oder privaten Persönlichkeiten zu irgendeiner Zeit oder bei irgendeiner Gelegenheit zulässig oder gestattet, ihrer Erwähnung zu tun und Prozesse oder Verfolgungen vor irgendwelchen Gerichtshöfen oder in irgendwie gearteten Rechtsverfahren einzuleiten. Es sei unseren Untertanen jedes Standes und jeder Art verboten, das Gedächtnis daran zu erneuern, sich gegenseitig anzugreifen, zu beleidigen oder herauszufordern durch den Vorwurf des Vergangenen, aus welchem Grunde und unter welchem Vorwand auch immer, sich darüber in Wort und Tat auseinanderzusetzen, Erörterungen zu beginnen, sich zu streiten oder zu kränken und zu beleidigen, sondern sie sollen sich beherrschen und friedlich zusammenleben als Brüder, Freunde und Mitbürger, widrigenfalls sie als Friedensbrecher und Störenfriede der öffentlichen Ruhe und Ordnung zu bestrafen sind." So geschehen im Jahre 1598! Man hat sich also damals nicht gescheut, tabula rasa mit den Greueln der Bartholomäusnacht zu machen, deren Schrecken noch heute in der Erinnerung der Menschheit fortleben. Warum? Weil der Frieden und die öffentliche Ruhe und Ordnung die Tabula rasa nötig machen und vor dieser Notwendigkeit der Sühnegedanken zurückzutreten hat. Das Tabula-rasa-Prinzip ist dann in § l des Friedensvertrages von Münster zu einem "Heiligen Grundgesetz" erklärt und in § 2 folgendermaßen formuliert worden: "Beiderseits soll das ewig vergessen und vergeben sein, was von Beginn dieser Unruhen an, wie und wo nur immer, von der einen oder anderen Seite, hinüber und herüber, an Feindseligkeiten geschehen ist." Dann folgen Einzelheiten, die nicht interessieren. Schließlich heißt es: "Vielmehr sollen alle und jede, von hier und von dort, sowohl vor dem Kriege als während des Krieges zugefügten Beleidigungen, Gewalttätigkeiten, Feindseligkeiten, ohne jedes Ansehen der Person derart gänzlich abgetan sein, daß alles, was auch immer der eine von dem anderen unter diesem Namen beanspruchen könnte, in ewiger Vergessenheit begraben sei." Das ist es, was wir heute das Prinzip der Tabula rasa nennen. Dieser Grundsatz ist als völkerrechtliches Prinzip seitdem in jedem Friedensvertrag der neueren Zeit ausdrücklich stipuliert worden, zuletzt im Frankfurter Frieden von 1871, der den deutsch-französischen Krieg beendete. Dort heißt es in Art. II Abs. 2: "Kein Bewohner der abgetretenen Gebiete darf wegen seiner politischen oder militärischen Handlungen während des Krieges in seiner Person oder seinen Gütern verfolgt, beunruhigt oder verhaftet werden." Tabula rasa! Das ist eine alte Weisheit, die nur in der Wirrnis unserer Zeit verloren ging, auf die die Völker sich aber wieder besinnen müssen. Sie müssen wieder erkennen, daß es Amnestien gibt, die Rechtsamnestien sind, keine einfachen Gnadenakte, Rechtsamnestien, auf die die Völker einen Anspruch haben, einen Anspruch, der nicht auf dem Paragraphenrecht beruht, sondern der ein Recht höherer Art ist, ob man das nun Naturrecht oder etwa ein völkerrechtliches Postulat nennt. Es besagt, daß nach Krieg und inneren Umwälzungen, wenn die gewöhnlichen Rechtsmittel versagen, der Staat oder die Staaten zu außergewöhnlichen Rechtsmitteln greifen müssen, um dem Recht im höheren Sinne, der höheren Gerechtigkeit, zum Siege zu verhelfen. Wir müssen die Diskussion um die sogenannten Kriegsverbrecher auf eine höhere Warte heben, ein höheres Niveau, aus dem Streit der Paragraphen und des positiven Rechts auf die höhere Ebene des Naturrechts und des ungeschriebenen Rechts. Das führt zu der Erkenntnis, daß eine allgemeine Befriedungsamnestie eine unabdingbare, notwendige, selbstverständliche Klausel jedes Friedensvertrages ist. Diese Lehre ist namentlich von den französischen Völkerrechtslehrern entwickelt worden, z. B. Despagnet, der in seinem großen Werk über das Völkerrecht: Cours de Droit International Public54 ausführt, daß die Generalamnestie eine clause sous-entendue de toute paix, d. h. eine stillschweigende selbstverständliche Klausel jedes Friedensvertrages ist. Dasselbe wird von Bonfils und Fauchille gelehrt, die ausführen, daß es ganz gleichgültig ist, ob die Klausel der Generalamnestie in einem Friedensvertrag ausdrücklich stipuliert ist oder nicht. Sie gilt immer auch als ungeschriebenes Recht, als völkerrechtliches Gewohnheitsrecht. Denn man unterscheidet geschriebenes und ungeschriebenes oder, wie man auch sagt, gesatztes und ungesatztes Recht. Das Gebiet des ungeschriebenen Rechtes ist viel größer als das des geschriebenen Rechtes. Man muß es nur erkennen. Die Richter, die Staatsanwälte, die Staatsmänner und die Regierungen müssen das ungeschriebene Recht erkennen. Namens dieses ungeschriebenen Rechtes, des Naturrechtes und der höheren Gerechtigkeit fordern wir heute, daß man endlich Schluß macht, daß man unsere Gefangenen freigibt, daß keine Verfolgungen mehr stattfinden wegen irgendwelcher Handlungen, die mit dem Krieg und dem deutschen Zusammenbruch zusammenhängen. Denn wir wollen wieder aufbauen. Haß und Rache, Bitterkeit und Vergeltung sollen verschwinden, die Wunden des Krieges sollen geheilt werden, friedliche Beziehungen sollen wiederhergestellt werden unter den Völkern. Das geht nur, wenn die Leidenschaften des Krieges, die heutzutage durch Propaganda in gefährlicher Weise gesteigert wurden, abgebaut und die Gefühle des Hasses überwunden werden. Ein neues Zusammenleben der Völker ist nicht möglich ohne allgemeine Beruhigung, Befriedung, Entspannung, Wiederherstellung des Vertrauens. Die öffentliche Meinung in den Ländern, in denen das Kriegsbeil begraben werden soll, darf nicht länger durch politische Prozesse, Strafvollstreckungen und Rechtskämpfe um Befreiung und Rehabilitierung beunruhigt werden. Denn es geht heute nicht mehr um schuldig oder unschuldig, nicht mehr darum: Wer hat Recht? Wir wollen den Streit beenden! Mit Einzelbegnadigungen und Überprüfungen ist das Problem nicht zu meistern. Das im Art. 6 des Überleitungsvertrages gewählte System bringt uns keine Befriedung. Ich habe als Anwalt genügend Einzelkämpfe um Befreiung von Menschen geführt, um nicht jedes Mittel zu begrüßen, das zur Befreiung von Kriegsverurteilten führt. Aber ich habe nie eine so tiefe Befriedigung gefühlt als 1924 auf dem Londoner Kongreß, als uns endlich durch die Generalamnestie die totale Befreiung aller letzten Opfer des Krieges und des Ruhrkampfes gelang und damit alle Prozesse dieser Art mit einem Schlag zu Ende waren.55 Die Einzelbegnadigung hat nie die Wirkung einer Befriedung. Es gibt da immer Unzufriedene. Die einen, weil sie gegen die Freilassung protestieren, die anderen, die sagen: "Warum der? Warum nicht ich?" Wenn wir nicht die Generalamnestie erreichen, werden wir in zehn Jahren noch nicht zur Ruhe kommen! [Anm. d. Scriptorium: Und in der Tat sind wir auch nach fünfzig Jahren noch nicht zur Ruhe gekommen, denn die Kriegsverbrecherprozesse gehen weltweit bis heute weiter...] Seitdem ringen wir um den Schlußstrich, der allein die Wiederaufrichtung eines Rechtsstaates ermöglicht. In Essen hat sich ein überparteilicher Ausschuß gebildet, der die Tradition des Ausschusses von 1929/30 wiederaufgenommen hat und von allen, die es angeht, den Erlaß einer Generalamnestie fordert. Diesem Ausschuß sind schon über 160.000 individuelle Zustimmungserklärungen aus allen Teilen der Bevölkerung zugegangen. Die nicht gewährte Generalamnestie hat die Gerichte heute vor ähnliche Schwierigkeiten gestellt, wie wir sie nach dem ersten Weltkriege erlebt haben. Diesmal sind es nicht die obersten Gerichte, die, wie damals das Reichsgericht, in der Lösung des Problems vorangehen, sondern die erstinstanzlichen Gerichte, die den Mut haben, dem Rechtsgedanken der Tabula rasa dadurch Geltung zu verschaffen, daß sie mit durchaus zutreffenden tatsächlichen Feststellungen bei der Würdigung des objektiven und subjektiven Tatbestandes zu Freisprechungen gelangen. Noch aber fehlt es an einer oberstrichterlichen Entscheidung über das, was man die Ipso-facto-Wirkung des Tabula-rasa-Prinzips56 nennen könnte. Daß die Tabula rasa eine Notwendigkeit ist, haben alle verstanden. Man hat nur noch nicht erkannt, daß die normative Kraft des Faktischen sich dahin auswirkt, daß das Tabula-rasa-Prinzip auch ohne ausdrückliche Vereinbarung in einem Friedensvertrag und ohne Gesetz in Rechtskraft erwachsen kann. Dieser Zustand ist aber heute eingetreten. Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Lage, wie sie in der Weltgeschichte noch nie bestanden haben dürfte. Wir haben noch keinen Friedensvertrag. Wir wissen nicht einmal, ob und wann wir den Friedensvertrag bekommen werden. Aber wir wachsen in den Frieden hinein. Es gibt Rechtswirkungen der Kriegsbeendigung, die normalerweise mit einem Friedensvertrage eintreten, die aber heute de facto auch schon ohne Friedensvertrag Wirklichkeit werden, weil dies einfach eine Folge der normativen Kraft des Faktischen ist. Dazu gehört in erster Linie das Tabula-rasa-Prinzip, weil es die unerläßliche Vorbedingung für die Befriedung und ein weiteres Zusammenleben der Völker ist. Dieses Prinzip ist publici juris. Es entspringt dem öffentlichen Recht. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften müssen also meines Erachtens schon heute die Einleitung und Durchführung von Strafverfahren wegen Kriegsverbrechens ablehnen. Die Verfahren sind einzustellen. Es bedarf dazu keines besonderen Amnestiegesetzes mehr. Dabei wird man sich von der Rechtsprechung des Reichsgerichts über Interessenkollisionen und Güterabwägung leiten lassen müssen.57 Die Befriedung der Menschen und die Notwendigkeit des Zusammenlebens ist das höhere Rechtsgut, vor dem der Sühnegedanken zurückzutreten hat. Wir leiden heute an einer Überspannung des Sühnegedankens. Wenn wir alle wie Shylock handeln wollten oder wenn der Grundsatz: Auge um Auge, Zahn um Zahn! ewig Geltung haben sollte, würde die Menschheit zugrunde gehen. Wir wollen gewiß den Sühnegedanken nicht bagatellisieren. Auch die Sühne ist ein Rechtsprinzip. Sie ist sogar eine der Grundlagen des Rechtsstaates überhaupt. Aber es gibt kein Rechtsprinzip, das überspannt werden dürfte. Unser schärfster Gegner im Kriege, Winston Churchill, hat dies als einer der ersten erkannt. Er hat in der ersten Sitzung des britischen Unterhauses nach dem Nürnberger Prozeß erklärt: "Nun aber Schluß mit Rache und Vergeltung!" Die Generalamnestie, die ich als das wichtigste Heilmittel für die Krankheit unserer Zeit ansehe, ist aber nur möglich, wenn der Geist anders wird, in dem wir alle in unserer Generation gelebt haben. Da es sich um eine geistige Erkrankung handelt, muß zunächst eine geistige und seelische Umstellung erfolgen, wie ja das Geistige und Seelische überhaupt das Wichtigste ist, das bei jeder Erkrankung zu beachten ist. Wir müssen wieder zusammen finden! Wir müssen uns wieder verstehen! Es ist nicht das Recht allein, auf das wir uns wieder besinnen sollen. Dazu gehört auch etwas - Liebe! Die "Macht der Liebe", der Urgrund der Kräfte, aus denen heraus sich unsere abendländische Kultur entwickelt hat, die christliche Idee und die der Antike, muß wieder lebendig werden in den Herzen. Erinnern wir uns des Ausspruchs der Antigone: "Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da", und des christlichen Ausspruchs: "Die Liebe aber ist die größte unter ihnen." Man braucht nicht zu vergessen, aber man kann vergeben. Gerade die, die unter der Not des Krieges und der Nachkriegswirren und all dem Unrecht, das damit verbunden war, am meisten gelitten haben, sind zuerst zum Vergeben bereit. Die Versöhnung wird von denen kommen, die gelitten haben. Zwei Frauen haben hier ein leuchtendes Beispiel gegeben, Frau Erzberger und Frau Rathenau. Diese Frauen, die vielleicht am meisten ein Recht auf persönliche Sühne hätten, haben sich zu der Erkenntnis durchgerungen, daß höher als ihre persönliche Sühne das Allgemeinwohl steht, das nach Befriedung verlangt, und sich so weit überwunden, daß sie sich für die Begnadigung der Mörder eingesetzt haben. Die Umstellung der Geister ist im Gange, auch bei den Völkern, die im Krieg unsere Gegner waren. In der französischen Zeitschrift Monde Nouveau, 8. Jahrgang, Nr. 62, vom Oktober 1952 hat der französische Oberst Henri Frenay, der ab 1940 unter de Gaulle Chef der Geheimarmee und Widerstandskämpfer war, zusammen mit dem Schweizer Pierre Boissier vom Internationalen Roten Kreuz unter dem Titel: "Auf daß Gerechtigkeit werde..." einen Artikel veröffentlicht, dem man die Achtung nicht versagen kann. In diesem Artikel versuchen die Verfasser den Deutschen den Standpunkt der französischen Widerstandskämpfer klarzumachen, sind aber in gleicher Weise ehrlich bemüht, der Einstellung der Deutschen gerecht zu werden. Wir begreifen, welches Hindernis die Greuelfrage dabei bildet. Wie bedeutsam ist der Satz S. 7 des Artikels: "Hätten sie diese Greuel nicht begangen, so hätte man vielleicht auch die eigentlichen Kriegsverbrecher nicht verfolgt; zumindest aber wären deren Prozesse nicht unter dem zweifellos gegebenen Einfluß so belastender Erinnerungen abgelaufen!" Wie mutig die Feststellung S. 8: "Strafe im Rahmen der Justiz ist unmöglich ohne ein Gesetz, das dem Richter sagt, was ein Verbrechen ist und was nicht. Andernfalls handelt es sich nicht um Justiz, sondern um Rache oder Vergeltung, und die 'Rächer' können keinen Anspruch darauf erheben, die Hüter des Rechts zu sein." Es zeugt von einem starken Wahrheitswillen, wenn die Verfasser S. 8/9 des Artikels schreiben: "Die deutschen Soldaten, die ihr nationales Gesetz verletzt hatten, waren schon von ihrem eigenen Staat bestraft worden, oft sogar mit einer unvorstellbaren Härte; diejenigen aber, deren man bei Ende der Feindseligkeiten habhaft werden konnte, hatten meistens das, was für sie Gesetz war, nicht verletzt." Die nationalen und internationalen Rechtsfragen, die durch die Kriegsverbrecherprozesse aufgerollt werden, werden dann mit einer ungewöhnlichen Klarheit dargestellt. Man kommt S. 28 zu dem Schluß: "Politisch gesehen war der Modus der Bestrafung der Kriegsverbrechen ein ausgesprochener Fehler, denn anstatt zu befrieden - worin die vornehmste Aufgabe der Justiz besteht - ist durch ihn ein der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit abträglicher Antagonismus genährt, wenn nicht gar aufs neue entfacht worden." Die Verfasser geben dann S. 40 zu, "daß Irrtümer geschehen sind. Sie wünschen, daß man diese korrigiert, und schlagen praktische Lösungen vor. Darüber hinaus aber wollen sie - und diese Seite der Frage erscheint ihnen besonders wichtig - mit all ihrem guten Willen, daß diese Kriegsverbrecherfrage aufhört, ein Dorn im Fleische Europas zu sein, und daß namentlich die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland nicht mehr davon berührt werden. Um das zu erreichen, schien ihnen eine Auseinandersetzung erforderlich, und daß jedem die Möglichkeit gegeben wird, den von der Gegenseite vertretenen Standpunkt zu verstehen." Der Artikel endet S. 43 mit einem Appell an das ungeschriebene Recht, das "wir in uns tragen": "Es müßte daher das geschriebene Gesetz, das ja zur Vermeidung von Willkür notwendig ist, in der Anwendung oft durch die Grundsätze erhellt werden, die über ihm stehen und seine Ausarbeitung bestimmt haben. Diese Grundsätze sind unbestimmbar. Wir tragen sie in uns, und sie lassen uns instinktiv das Wahre und Falsche, das Gerechte und das Ungerechte spüren. Diese den menschlichen Gesetzen übergeordneten Prinzipien sind es, die morgen dem Richter bei seiner schweren Aufgabe zur Seite stehen müssen. Dieses mächtige, doch verworrene Streben, das sich in der Tiefe unseres Gewissens regt, ist die Grundlage unserer Zivilisation. Es ist das noch ungeformte Bindeglied zwischen den europäischen Völkern, die mühsam und qualvoll den Weg zu ihrer Einheit suchen." Sind das nicht alles Gedanken, die geeignet sind, uns miteinander zu verbinden und zu versöhnen? In Frankreich hat sich wie in Deutschland ein Arbeitsausschuß zur Herbeiführung einer Generalamnestie gebildet. Er hat ein Manifest erlassen, das von dem Präsidenten der Bruderschaft von Notre Dame de la Merci, dem Admiral Lacage, dem Präsidenten des Komitees zur Verteidigung der christlichen Zivilisation, von Jean Montigny, dem Präsidenten der Union der unabhängigen Intellektuellen, von Louis Rougier, dem Präsidenten der Union für die Wiederherstellung und Verteidigung der öffentlichen Dienste, d. h. also der Beamten, und von Hélène Suzannet, der Präsidentin des französischen Komitees für die Verteidigung der Menschenrechte, unterschrieben ist. In diesem Manifest heißt es: "Die Epuration (Säuberung) hat in allen ihren Formen, strafrechtlich, administrativ und politisch, bei den Gewerkschaften und Berufsverbänden, die Grundsätze der Erklärung der Menschenrechte von 1789 und die wesentlichen Prinzipien des Rechts verletzt. Der Ernst der nationalen und internationalen Lage verlangt die Wiederversöhnung aller Franzosen, die dieses Namens würdig sind." Auch in England haben sich führende Persönlichkeiten wie der Bischof von Chichester Allen Bell und der frühere englische Staatssekretär Hankey in den Dienst des Gedankens der Generalamnestie gestellt.
Der Gedanke der Generalamnestie ist also auf dem Marsche. Möge ein gütiger Gott
den Mächtigen dieser Erde die Einsicht geben, daß der Schlußstrich gezogen
werden muß, der allein den Frieden verbürgt, den die gequälte Menschheit
erfleht.
39Sethe, Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 16. April 1953. ...zurück...
40Sitzungsbericht des Deutschen Bundestages 1950,
S. 1592 ff., 1605 ff., 3104 ff.; 1951, S. 6297 ff., 6476 ff.; Protokolle des Deutschen Bundesrates
1950, S. 429 ff. ...zurück...
41Deutscher Bundestag 1950, S. 1592 ff.; Ehlers in
Dombois (Anm. 2), S. 27. ...zurück...
42Deutscher Bundestag 1950, S. 1592. ...zurück...
43Deutscher Bundestag 1950, S. 1597. ...zurück...
44Deutscher Bundestag 1950, S. 1548, 1600, 1602.
...zurück...
45Deutscher Bundestag 1950, S. 1597, 1601. ...zurück...
46Deutscher Bundestag 1950, S. 1602. ...zurück...
47Protokolle des Deutschen Bundesrates 1950, S.
429. ...zurück...
48Deutscher Bundestag 1950, S. 3114; 1951, S.
6304. ...zurück...
49Deutscher Bundestag 1950, S. 3118. ...zurück...
50Deutscher Bundestag 1951, S. 6297. ...zurück...
51Deutscher Bundestag 1951, S. 6478. ...zurück...
52Dombois-Ehlers (Anm. 2), S. 5. ...zurück...
53Grimm, Generalamnestie als
völkerrechtliches Postulat, Köln, Westdeutscher Verlag 1951; Grimm,
Generalamnestie, Der einzige Weg zum Frieden, Freiburg i. Br. 1952. ...zurück...
54Paris 1905, S. 570 ff. ...zurück...
55Deutsche Juristenzeitung 1924, S. 29, 569,
579, 699, 705. ...zurück...
56Grimm, Grundsatzplädoyer im
Petersenprozeß, Hamburg 1953. ...zurück...
57RGST. 61, 242 ff. ...zurück...
|