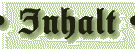|
 Elftes Kapitel Die Buschmänner, eines der ältesten Urvölker, am Aussterben • Die letzten Exemplare in Südwest • Das Tierparadies im Norden des Landes • Wenn der Herrscher des Busches wie Donner grollt, dann schweigen alle Kreaturen. "Die Buschmänner sind eines der ältesten Urvölker der Welt und werden in 50 Jahren ausgestorben sein. Die letzten Exemplare sind noch in der Kalahari, im Osten, einige auch im Norden von Südwest und im Betschuanerland zu finden. Sie sind sehr scheu, und wenn sich ein Weißer und ein wilder Buschmann auf seinem Territorium treffen, so bleibt einer von ihnen auf dem Platz. Ihre vergifteten Pfeile treffen sicher und töten unfehlbar." Solche und ähnliche Erzählungen stachelten meine Neugierde an. Während der langen Bahnfahrt durch die dürre Buschsteppe nach dem Osten zog alles über die Buschmänner Gehörte durch meinen Sinn.
Ihre Hütten von ungefähr 1,20 Meter Höhe und Tiefe stellen sie grottenartig aus Baumästen zusammen und überdecken sie mit trockenem Gras. Ein Kral aus Dornbüschen darum soll vor Raubtieren schützen. Ihre Kleidung besteht aus einem Lendenschurz, gegebenenfalls noch aus einem Rückentuch von weichgeklopftem Wildleder. Das weibliche Geschlecht trägt seinen Schmuck in Form von Ketten aus Straußeneierschalen. Ein Buschmannsdorf umschließt eine Familie und hat ungefähr 10 bis 15 Hütten. Jedes einzelne Familienmitglied, außer den ganz kleinen Kindern, hat seine eigene Behausung. Es ist allerdings auch nicht sehr schwierig Buschmanns-"Häuser" zu bauen. Auf einem holzreichen Gebiet ist der Bau an einem Tag erledigt. Jede Niederlassung hat ihr genau begrenztes Jagdgebiet, und wehe dem, der im Eifer bei der Verfolgung eines Wildes die Grenze überschreitet. Kein langes Gericht, sondern ein vergifteter Pfeil des Nachbarstammes ahndet erbarmungslos das Verbrechen. Männer und Frauen sorgen zu gleichen Teilen für die Ernährung der Familie. Am frühen Morgen zieht das Volk aus, die Männer auf die Jagd mit Pfeilen und Schlingen, die Frauen mit ihren Sammelfellen in die Büsche und Steppe, zum Sammeln von Nahrungsmitteln. Hier suchen sie nach wilden Früchten, nach eßbaren Wurzeln und Knollen, nach [135] Vogeleiern, aber auch nach Fröschen, Eidechsen, Raupen und viel anderem ähnlichen Getier. So ziemlich alles, was da kreucht und fleucht, wird mitgenommen und am heiligen Feuer, das nie ausgehen darf, soll es nicht Unglück bringen, geröstet oder gebraten. Ackerbau und Viehzucht kennen die Buschmänner nicht. Sie sind ein Jägervolk, das einmal da, einmal dort, aber immer innerhalb der ihm gezogenen Grenzen, seine Hütten aufstellt. Der Umzug erfordert auch weiter keine Umstände, da jeder Buschmann seinen Besitz mit Leichtigkeit zu tragen vermag. So dürftig und primitiv das Volk auch ist und lebt, so hat es, wahrscheinlich aus seinem natürlichen Instinkt heraus - der dem verbildeten Europäer abhanden gekommen ist - begriffen, was zur Erhaltung und zur Erstarkung der Rasse wichtig und notwendig ist. Ein Säugling, der nicht recht emporkommen will und siech und krank erscheint, wird nach einem Beschluß der älteren Frauen ohne weitere Umstände begraben. Dasselbe geschieht mit einem Kind, dessen Mutter bei der Geburt stirbt, wenn nicht zufällig eine andere Frau vorhanden ist, die das Kind zu nähren vermag. Tiermilch kennt das Jägervolk nicht und kann daher einen Säugling ohne Mutter nicht aufziehen. Dem gleichen, in der Ausführung gewiß grausamen, dem Volke aber dienenden Schicksale verfällt das Kind, das zur Welt kommt, bevor das vorhergegangene in der Lage ist, sich von der rauhen Feld- und Jägerkost zu nähren. Der Buschmann zieht hier eine notwendige und gewiß harte Konsequenz. Er steht vor der Wahl, infolge Nahrungsmangels entweder beide Kinder zu verlieren, günstigstenfalls aber zwei Schwächlinge heranzuziehen, oder aber das neugeborene zu opfern und aus dem älteren einen kräftigen und widerstandsfähigen Menschen zu erziehen. Und er wählt aus seinem Urinstinkt heraus das zur Erhaltung seiner Rasse am zuträglichsten, das letztere. Zeigt der Buschmann in diesem Falle einen sicherlich nur instinktmäßigen Weitblick, so sündigt er durch seine Blutrache an dem Bestand seiner Rasse und trägt selbst zur Vernichtung derselben bei. Ganze Sippen werden dadurch mitunter ausgerottet, die Männer getötet, die Frauen in Gefangenschaft hinweggeführt und - geheiratet. Doch die Dezimierung des Buschmannstammes ist nicht so sehr durch die Blutrache bedingt als durch den Umstand hervorgerufen, daß der Buschmann von der anderen Menschheit, ob weiß oder schwarz, bis vor kurzem nicht als Mensch anerkannt, sondern wie Freiwild gejagt und ge- [136] tötet wurde. Die Hereros, die Namas, die Ovambos, sie alle trachteten ihn auszurotten, um sich seine Jagdgründe zu sichern und anzueignen, und es gab eine Zeit, da südafrikanische Staaten unter weißer Herrschaft einen Preis für jede Buschmannsnase aussetzten. Daher ist es wohl nicht verwunderlich, wenn manch heimtückischer Pfeil aus irgendeinem Hinterhalt, hier und dort, schwarze aber auch weiße Menschen niederstreckte. Das Vordringen der schwarzen und weißen Rasse hat sie ferner immer weiter aus ihren fruchtbaren und wildreichen Gebieten zurückgedrängt, hinein in die Wüste und in Länderstrecken, die beinahe keine Existenzmöglichkeiten mehr bieten. Man schätzt die Zahl der heute noch lebenden Buschleute auf ungefähr 2500 - 3500, die auf ein Gebiet von ungefähr 60 000 Quadratmeilen verstreut sind. In 50 Jahren schon, so berechnet man, werden vielleicht die letzten Exemplare noch als Seltenheit zur Schau gestellt werden. Von einem Stamm kann dann kaum mehr gesprochen werden. Die Buschleute stehen auf dem Aussterbe-Etat. Ich kam in der kleinen Hauptstadt des großen Bezirkes Gobabis an. Ein Lastwagen brachte mich zu einem Farmer, in dessen Nähe sich Buschleute aufhielten und der sie zusammenzutrommeln versprach. Und sie kamen an, am nächsten Tag, einige mit europäischen Kleiderfetzen, andere in ihr Wildlederfell in ursprünglicher Art gekleidet. Die Frauen prangten im Schmuck ihrer Straußeneierschalen, trugen aber auch schon den nicht eigentlich zu ihnen gehörigen Metall- und Perlenschmuck. Klein von Gestalt, mit zierlichen Händen und Füßen, schlichen sie schüchtern heran. Ihre gelbe Hautfarbe und die schlitzförmigen Augen setzten mich einigermaßen in Erstaunen und schienen mir eher auf asiatische als afrikanische oder europäische Abkunft schließen zu lassen, welcher Eindruck durch die plattgedrückte breite Nase noch verstärkt wurde. Steif und still und ersichtlich etwas ängstlich standen sie beim Photographieren. Als aber der Farmer zur Belohnung Tabak, Zucker und Streichhölzer in ihre Sammelfelle gab, da wurden sie lebhaft und gaben ihrer Freude in einer von mir noch nie gehörten, sonderbaren Ursprache Ausdruck. Es ist für einen frischimportierten Europäer kaum möglich, sich unter den dumpfen schnalzenden Lauten eine geordnete Menschensprache vorzustellen; er wird vielmehr von unartikulierten Lauten sprechen. Und doch ist sie ersteres, wenn auch in einfachster Form. Ein Europäerkind, das in der Umgebung von Buschleuten aufwächst, kann sie ohne weiteres erlernen und beherrschen. Nicht so leicht ein Erwachsener. [137] Das Völkchen verschwand. Der Wagen, der mich abzuholen kam, lief an. Ich winkte zurück zu meinen Gastgebern - da plötzlich ein Ruck, ich flog nach vorne, ein Schlag, zersplittertes Glas umklirrte mich, und Blut floß über mein Gesicht. Ich war mit dem Kopf durch die Scheibe des Wagens gerannt. Der Wagen war gegen einen Pfahl des Zaunes geprallt. Breit und höhnend klaffte der freie Torraum neben uns. Das allseits so gerühmte Windhuker Bier hatte mir seine angezweifelte Güte mit tüchtigen Kratzern und Schrammen ins Gesicht gezeichnet und bewiesen. Meine Reise führte mich weiter nach dem Norden, und am Guinassee hatte ich endlich Gelegenheit, ein kleines Buschmannsdorf mit seinen grottenähnlichen Hütten zu sehen. Die Bewohner waren arm wie Kirchenmäuse. Außer Bogen und Pfeil, deren Besitz sie jetzt - zur Schonzeit des Wildes - leugneten, die sie aber doch wohl irgendwo versteckt hielten, war ihr wichtigstes und hauptsächlichstes Eigentum ihre Tabakspfeife und ein Kochtopf, früher selbstgefertigt aus Ton, heute zuweilen aus Metall. Vor ihren Hütten, hinter dem Dornbuschkral hockten sie auf ihren Beinen am Feuer, die älteren Personen mit ihrem typischen, von eigenartigen Hautfalten umgebenen Bauch - die Vorratskammer dieser Menschen. Unglaubliche Mengen von Lebensmitteln vermag der Buschmann zu vertilgen, so daß schließlich die in Falten gelegte Haut am Leib sich straff spannt. Tagelang kann nun der Mann ohne Nahrungsmittel auskommen, bis der Bauch schließlich wieder zusammenfällt und die groben Falten ihn wieder umgeben. Die weise Natur hat auch hier ein Mittel gefunden, der armen dürftigen Kreatur, die sich nicht recht selber zu helfen vermag, beizustehen. Nicht alle Tage ist dem Buschmann das Jagdglück hold. Ein andermal wieder schleppt er ein Großwild nach Hause. Um es vor der hier rasch einsetzenden Verwesung zu schützen, verzehrt er es sofort mit Stumpf und Stiel. Die Vorratskammer ist gefüllt für einige Tage und bis dahin findet sich schon wieder irgend etwas Genießbares. Trotz aller Primitivität soll das Volk nach dem Missionar Dr. Vedder, der als bester Kenner der verschiedenen Eingeborenenrassen gilt und der auch die Buschmänner eingehend studierte, eine ganz eigenartige Poesie und einen reichen Schatz an Sagen und Märchen haben. Dr. Vedder sagt:
"Kein Volk südlich vom Kunene, Okavango und Sambesi hat so viele Mythen, Sagen und Märchen als dies dürftige Völkchen, das seinen Besitz mit einer Hand aufzuheben vermag. Kaum eine Naturerscheinung gibt [138] es, über deren Entstehung und Bedeutung es nicht eine Mythe oder ein Märchen zu erzählen wüßte. Die Entstehung von Berg und Tal, Fluß und Feld, Quelle und Kluft, Baum und Strauch, Tier und Mensch, Gewitter und Regen wird in ausführlichen Erzählungen behandelt. Wären sie alle gesammelt, so ergäbe sich daraus eine Buschmannsphilosophie sonderbarster Art, deren besonderem Reiz sich der Leser gewiß nicht verschließen könnte, und die die geringe Meinung, die mancher von den Buschmännern hegt, gewiß zu ihren Gunsten umgestalten würde."

Wir stiegen aus und standen nach einigen Schritten am Guinassee. Das war das erste offene Wasser, das ich in Südwest, ausgenommen von Brunnen gespeisten Viehtränken, sah. Kein Wässerchen fließt in Südwest, kein Bächlein, kein Flüßchen zur Trockenheit. Leere, sandige Flußbette gähnen. Und hier war wirklich Wasser. Zwar blinkte es nur in dumpfer stahlblauer Farbe herauf, denn es lag tief in steile Felsenwände eingebettet, und kein Strahl der Sonne ließ es aufzittern in Licht und Glanz. Einst lag der Wasserspiegel viel höher. Drei Jahre Trockenheit haben das Wasserniveau in Südwest bedeutend gesenkt. Der Guinassee hat einen Bruder, nur etwa 15 Kilometer von hier. Sie sind die einzigen Seen, die das Land hat. Doch ist ihre räumliche Ausdehnung nicht sehr groß, die Spiegelfläche entspricht der Größe eines Gewässers, das wir Teich nennen. Aber vielleicht rechtfertigt ihre unendliche Tiefe den Namen See. Beide Seen stellen ein Wunder in Südwest dar. Wir gingen weiter. Schwarze Menschen begegneten uns. Auf einem kleinen Kaffernklavier klimperte einer der Ovamboneger. Da bot er es plötzlich einem meiner Begleiter zum Kaufe an. "Was willst du haben?" "5 Schillinge!" "Du bist ein Jude!" Empört fuhr der Schwarze auf und er verwahrte sich ganz energisch [139] dagegen, ein Jude genannt zu werden. Der Grund ist nicht der, daß die Neger vielleicht eine Ahnung hätten von der zur Zeit die Welt bewegenden Judenfrage. Nein! Aber sie haben das ausbeutende Wesen des Juden während ihrer Arbeitszeit in der Kupfermine in Tsumeb bereits sehr unangenehm am eigenen Körper verspürt. Die Glanzzeit dieser Mine war für jüdische Handelshäuser durch skrupellose Übervorteilung des schwarzen Arbeiters ein ergiebiges Erntefeld. Endlich hatte sich der Mann beruhigt. Er führte uns eine Strecke weit zu einer Viehtränke und erklärte dann: "Hier ging gestern der Löwe in die Falle." "Es ist alles ausgetrocknet, kein Wasser in der Steppe, deswegen kommen sie so nahe heran zu den Tränken, so nahe zu den Menschen", sprach ein Weißer. Ich betrachtete die eiserne Falle, die aufgestellt die Höhe eines Menschen erreichte und den dicken Baumstamm, an dem sie hing und mit denen beiden zusammen (4 Zentner Gewicht) der König der Tiere schmerz- und wutbrüllend noch 500 Meter weit gerast ist. Er trieb die Eingeborenen auf die Bäume in namenlosem Schreck durch sein zornbebendes Gebrüll, der Herrscher der Steppe. Man hat ihm ein Grab gemacht, nachdem der Weiße ihn abgeschossen und die Trophäe, das Fell, mitgenommen hatte - ein Grab mit Steinen beschwert, und Schwarze umstanden es. "Wohin hat der Weiße den Löwen getroffen?" Da zeigten sie alle auf ihre Nase. Es war ein komisches Bild, und auch ich konnte mich des Lächelns nicht erwehren, obwohl ich innerlich verärgert war. So nahe lag der Schauplatz von Tsumeb, und man hatte nicht daran gedacht, den Besuch aus Deutschland, der nie mehr im Leben Gelegenheit haben würde, dergleichen zu sehen, gestern schon mitzunehmen. Doch ein Gedanke tröstete mich. Ich würde ja noch viel Wild sehen, herdenweise auf freier Bahn in der Etoschapfanne. Wieder holperte der Wagen eines Nachmittags hinein in den Busch. Am Steuer saß Pg. Linde und im Wagen mein liebenswürdiger Gastgeber in Tsumeb, Herr v. Blomberg, Herr Heinzelmann und meine Wenigkeit. In uns beiden letzteren brannte das Jagdfieber. Herdenweise wollten wir sie zur Strecke bringen, die Tiere auf freiem Feld. Zwar hatten wir kein Gewehr mit, denn die Etoschapfanne ist Wildreservat, und Jagen ist dort verboten. Aber wir zückten schon unternehmungslustig unsere Kameras; auf die Platten wollten wir sie bannen, sie so erjagen, [140] und ich freute mich unbändig, daß wir sonst keine Waffe mithatten, ich bin nicht sehr für die Knallerei. Wir kamen an den Otikotosee, den Zwillingsbruder des Guinassees, dessen Wasser ebenfalls in Felsen eingebettet ist, doch lange nicht so tief liegt. Vor 25 Jahren noch diente das Wasser dem Wild zur Tränke. Heute aber ist es auch über einige Meter Felsentiefe von ihm nicht mehr erreichbar. "Hier herum gibt es eine Menge von Spuckschlangen, die ein giftiges Sekret nach Feinden und Beute verspritzen, ihre Opfer beinahe unfehlbar in die Augen treffen, sie dadurch blenden." Die Fahrt ging weiter durch knochendürren, ausgetrockneten Busch. Auf verknorrten Ästen saß hier und dort ein Nashornvogel, mit einer mächtigen, den ganzen Körper beherrschenden Schnabelnase. Sonst aber erschien der Busch still und tot in der Nachmittagshitze. Um 5 Uhr erreichten wir die Farm Hartmann, auf der wir, was bei der großzügigen Gastfreundschaft hierzulande selbstverständlich ist, unseren Kaffee tranken. Leider vergaß man mir zu sagen, daß Herr Hartmann einer jener sieben tapferen Reiter ist, die beim Hereroaufstand am 28. Januar 1904 im nahen Fort Namutoni 500 Ovambos, die sich mit ihren südlichen schwarzen Brüdern im Kampfe gegen die Weißen vereinigen wollten, zurückschlugen. Sonst hätte ich wohl einiges von ihm zu erfahren versucht. Wir hatten zu lange bei unserem Kaffeeklatsch verweilt, es dämmerte kurz nach unserer Weiterfahrt. Im Busch wurde es grau, und es knackte hier und dort. Plötzlich aber krachte und polterte es. Ein Tier, das mir riesengroß erschien, mit grauem Fell und mindestens 1 Meter langen, hochgestellten und leichtgeschweiften Stangen, brach durch. "Ein Gemsbock!" Ein Gemsbock? Na, was sich hier so Gemsbock nennt. Sollte auch die graue Dämmerung die Umrisse etwas verzerrt haben, bestimmt war das Tier so groß wie ein Pferd. Der letzte Widerschein der unterm Horizont verschwundenen Sonne tauchte die blendendweißen zinnengekrönten Mauern und die wehrhaften Türme der stolzen einstigen deutschen Feste Namutoni im nördlichsten Zipfel des Landes in rosenrotes Licht, als wir ankamen. Ein englischer Polizist trat aus einem kleinen Häuschen und prüfte unsere Erlaubnisscheine zur Betretung des Wildreservates. Er fand sie in Ordnung und war nun sehr liebenswürdig. [141] "Ist noch Wild in der Pfanne?" "Das ist es immer, Tag und Nacht!" "Wollen wir heute noch hineinfahren?" "Natürlich!" In mir fieberte die Erregung nach diesem gewiß einzigartigen Erlebnis. Der Polizist stieg zu uns in den Wagen. Wir fuhren durch den Festungshof und bogen rechts ab. Es dunkelte bereits stark, als wir nach etwa einem Kilometer eine große ebene Fläche vor uns erkannten und dort - dort, eine Herde von Tieren. Der Wagen raste auf sie zu, die noch verhofften und dem sonderbaren Untier entgegenstarrten. Dann aber stoben sie plötzlich auf und davon, Hunderte von Zebras. Aber es war zu spät. Sie hatten die Kraft und die Schnelligkeit des neuauftauchenden Tieres unterschätzt. Unser Wagen brauste hinein mitten unter sie, und die schwarz-weißgestreiften Tiere mit ihren rundlichen, gut genährten Hinterleibern sprühten auseinander, nach rechts und links. Wir folgten einem Trupp und jagten ihn vor uns her und überholten einzelne zum Greifen nahe. Schade, daß die vorgeschrittene Nacht es nicht mehr erlaubte, zu photographieren. Herr Linde am Steuer hielt das Rad fest in Händen, faßte diesen und jenen Trupp, fuhr halsbrecherische Schleifen und Kurven, über die wir uns zu anderer Zeit wohl entsetzt hätten. Aber hier waren wir alle im Banne dieser Jagd. Diese gespannte Elastizität der wie Seide glänzenden Tiere, diese schnelle Wendigkeit, die gesammelte Kraft! "Halt! Halt!" brüllte plötzlich der englische Polizist. Mit knapper Not konnte Herr Linde den Wagen noch auffangen vor einem dunklen Buschstreifen, der sich nun auch schon steil und hoch wie eine schwarze Mauer vor uns aufbaute. "Für heute ist es genug, es wird zu dunkel!" "Ich kann Ihnen Zimmer im Fort für die Nacht zur Verfügung stellen", bot uns liebenswürdig der Polizist an. "Danke! Wenn die Herren Lust haben, ich möchte lieber hier, vor der Feste, im Freien übernachten." Der freundliche Polizeimann ließ durch seine schwarzen Jungens sofort vier Matratzen heranschleppen. Mit Decken waren wir versehen. Für den Engländer war unsere Anwesenheit eine willkommene Ablenkung. Einsam und verloren liegt das Fort Namutoni nahe an der Grenze des portugiesischen Angola. Nicht viele Europäer verirren sich hierher. [142] "Meine Gesellschaft ist das Wild des Busches und oft spazieren die Löwen an meinem Fenster vorüber", erzählte er bei Lampenschein und Teegebräu. — Die Lampe war erloschen; tiefe Atemzüge von nebenan verrieten mir den Schlaf eines der Herren. Die Nacht war lau und der Halbmond übergoß die Landschaft mit freundlichem Schimmer. Weiße Wolken zogen, verdeckten die Sterne und enthüllten sie wieder. Meine Sinne aber lauschten hinein in das ursprüngliche Leben des nächtlichen Busches, in die lebendige Wildnis, die mir Gottesschöpfung näher brachte. Nachts lebt der Busch! Beinahe wie Hundegebell klang das absonderliche Gekläff der Zebras und ein immerwährendes Getrappel gab Kunde von den Herden, die vorüberstampften. Hin und wieder nur schnoben sie, wie Pferde tun. Das schrille Gelächter der Hyänen gellte unangenehm aus den hunderterlei anderen Tönen, aus dem Wispern und Raunen und Scharren und Bellen und Schnauben und Quietschen - die Nacht ist lebendig, lebendiger als der Tag. Herr Linde, links von mir, erhob sich vorsichtig, um nicht zu stören und ging weg; ging weg und kam nicht wieder. Ich lag wach im Lauschen der Natur, stundenlang - ist Herrn Linde etwas zugestoßen? Soll ich die anderen wecken? Doch er kam. "Ich hatte Angst um Sie." "Ich habe das Wild belauscht. Herdenweise ist es ganz nahe an mir vorübergestreift. Ich gehe wieder fort!" "Und ich gehe mit!" Der Mond war überzogen von Wolken und es war reichlich dunkel, als wir nun erst an der Mauer des Forts und dann am Abfluß der Quelle, am Wassergraben entlang tasteten. Diese wunderbare Quelle, einzig in Südwest, ist der Ursprung und die Seele des Tierparadieses hier. Dumpf auf grollte der Boden von den Hufschlägen einer Zebraherde. Hin und wieder blinkte das Wässerchen im Graben wie ein Lichtstrahl auf. Die zwei einzelnen Palmen am Grabenrand lispelten leise, wie träumend. Schwarze Schatten bewegten sich vor uns, standen am Graben, wanderten auf und ab und hin und her und durcheinander. Wie auf Kommando machte das Ganze plötzlich halt, eine überraschende Kehrtwendung, und ab fegte die Gnuherde, uns aus Rache Staub und Schmutz mit den Hinterläufen entgegenwirbelnd. Und oft standen wir still und dann dröhnte der Boden vor und hinter uns von dem Getrappel der Wildherden, doch [143] sie kamen nicht nahe; kaum konnten wir ihre dunklen Schatten in der Ferne erkennen, drehten sie auch schon bei und weg waren sie. Ihre feine Witterung spürte uns. "Am besten, wir setzen uns hinter einen Busch!" Wir saßen lange! Ferne von uns, unten und oben am Graben - wir hörten es nur an Geräuschen - befand sich Wild. Die Mitte des Grabens, unser Standpunkt, blieb frei, obwohl wir, nun von Busch gedeckt, kaum sichtbar sein konnten. Ein leises Geräusch hinter uns störte uns auf. Wir wandten beide den Kopf und blickten in zwei rötlich gelbe Lichter, die zu uns herüber starrten und geräuschlos sich vorsichtig näherten. Donnerwetter! Man beschleicht uns! Wir machten in der ersten Überraschung eine Bewegung, das Tier einen Satz rückwärts, die grellen, unheimlichen Augen waren verschwunden. Aber es dauerte nicht lange, die unangenehmen Lichter tauchten wieder auf. Das Tier, dessen Körperumfang in der Dunkelheit nicht zu erkennen war, blieb hartnäckig. Es hatte es auf uns abgesehen. Kein Zweifel, die Augen funkelten tückisch und verlangend und schlichen neuerdings näher. Na, so still und gottergeben will ich mich doch nicht auffressen lassen. Ich richte mich auf und will eben das Tier anbrüllen, da setzte es über einen Busch hinweg, fort. "Was war es?" "Das ist der Dunkelheit wegen schwer zu sagen, es könnte ein Leopard gewesen sein!" "Wir wollen lieber gehen. Stundenlang sitzen wir schon hier, das Wild meidet uns." Einige Meter weit waren wir gewandert, da zerriß ein durchdringender Schrei die mehr oder weniger dumpfen Laute der Nacht. Alles schien den Atem anzuhalten, es war unheimlich totenstill. Dann aber ertönte ein teuflisches Gelächter, ein wahnsinniges Freudengeheul. Ein Tier war geschlagen - ohne Zweifel. Eine Antilope - ein Zebra vielleicht. Aber ich konnte nicht glauben, daß ein Löwe oder ein Leopard darüber ein derartiges Gebrüll veranstalten würde, ich dachte vielmehr an Hyänen, die in Erwartung des Abfalles dieses mark- und beindurchdringende Geheul anstimmten. Als wir uns wieder unter der Decke streckten, ging es wie leises Grollen durch den Busch, das allmählich anschwoll. Und schließlich brüllte und donnerte es, hier und dort, nah und fern im Busch. Es schien um uns [144] herumzuschleichen und es gellte und tobte hinein in den grauenden, sonst stillen Morgen. Wenn der Herrscher des Busches wie Donner grollt, dann schweigen alle Kreaturen. — Am Morgen stiegen wir auf den Turm der Feste, um die Etoschapfanne übersehen zu können. Herden von Straußen und Springböcken tummelten sich friedlich zusammen, weitab äste eine Gnuherde, große Antilopen traten eben aus dem Busch und zogen dem Wassergraben zu. Eine anziehende Zebraherde meldete sich durch eine aus dem Busch aufsteigende Staubwolke an. Wild war an allen Ecken und Enden der viele Kilometer langen Etoschapfanne. Auf zur Jagd! Langsam pirschte der Wagen erst an eine Zebraherde heran. Vollgas! Doch ungleich gestern warteten heute die Tiere nicht erst auf uns, sondern trollten schon auseinander, bevor wir in eine Nähe kamen, die ein brauchbares Negativ ergeben hätte. Wir konnten immer nur einige aufs Korn nehmen, und die verstanden es meisterhaft, uns in ein Gelände hineinzuführen, das uneben und hügelig war und auf dem der Wagen abgestoppt werden mußte, wollten wir nicht Hals und Bein brechen. Schadenfroh stoppten dann auch die Zebras, sahen sich um und grinsten hämisch. Sie waren ebenbürtige Gegner auch dem Auto gegenüber. Und erst die Springböcke, diese zierlichen und feingezeichneten Tiere. Wie von Federn geschnellt sprangen sie in die Höhe, oft senkrecht und über ihre Brüder und Büsche hinweg, ein wundervolles Bild. Auch sie hielten uns zum Narren. Ehe wir nur einigermaßen aufzuholen vermochten, hatten sie schon den erspähten, schützenden Busch erreicht. Weniger intelligent erschienen mir die Gnus. Zwei abgesprengte Tiere verfolgten wir Kilometer um Kilometer auf schönster ebener Fläche. Sie verstanden es nicht, sich unebenes Gelände oder rettenden Busch zunutze zu machen, sondern liefen stur in gleicher Richtung in die Ebene hinein, immer vor uns her, und als wir sie einholten, schalteten auch sie noch ihren letzten Gang ein. Wir holten auf und die Tiere, ihr Letztes gebend, schwenkten nicht etwa ab, sondern brausten weiter an unserer Seite, in ganz gerader Richtung immerzu, bis wir uns von ihnen lösten. Die Strauße ließen uns überhaupt nicht an sich herankommen, sie gaben Fersengeld schon in weiter Ferne. Stundenlang pirschten wir herum mit Eifer und Lust. So zu jagen macht Freude. Das Wild zu sehen, friedlich äsend, oder in höchster Kraft- [145] entfaltung das Weite suchend, ist eine Augenweide. Und wenn auch das Zebra geringschätzig grinst, ich sehe lieber in die lustigen und etwas hämisch zwinkernden als in die anklagenden und weidwund brechenden Augen eines Tieres.
|