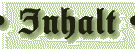|
 Achtes Kapitel Die unmögliche Insel im Meer • Südwest, Land und Leute • Fahrt durch die Wüste. Deutsch sprachen die Menschen um mich, ob groß ob klein, ob schwarz ob weiß, und deutsch leuchteten die Schilder von den Straßenfronten: Kaiserstraße, Bismarckhotel. Man sah, hier hatte ein starkes deutsches Geschlecht sich nicht unterkriegen lassen, trotz Schikanen, trotz Unterdrückung, trotz Ausweisungen. In Togo, da waren es nur noch zwei Deutsche, die Letzten ihres Stammes, die mich begrüßten, und in ganz Kamerun etwa 200. Hier aber war deutsches Leben und Treiben, waren deutsche Menschen um mich, wo ich ging und stand; deutsche Menschen und flimmernde Sonne bei Tag und sternenklarer Himmel bei Nacht. Kaum faßbar war mir jetzt, daß vor kurzem noch die Regenschauer des Monsun mich umsprühten, die Kleider vor Feuchtigkeit moderten. Nun war die Landschaft um mich wie ausgedörrt und die Luft so trocken, daß die Lippen sprangen und die Haut sich spröde anfühlte, und ganz leise Zweifel kamen mir, ob diesem ewigen, ex- [108] tremen Wechsel selbst die beste Gesundheit auf die Dauer gewachsen wäre. Aber das Klima hier ist ja nicht ungesund, es ist Weißen zuträglich. Ich trug seit Liberia zum erstenmal nicht mehr den Tropenhelm, ich nahm kein Chinin mehr. So ganz anders, so grundverschieden war das Land hier von dem Afrika, aus dem ich kam. In Togo und Kamerun üppigste Vegetation, undurchdringlicher grüner Urwald, und hier in Südwest Wüste und Dürre, Buschsteppe, unendliche Weite. In blendender Helle strahlten die Sanddünen von Walfischbay, als unser Schiff einlief, und die Sonne brannte mir warm ins Herz, als meine Freundin an Bord kam, mich abzuholen und ein Bote mir den Willkommengruß des Landesgruppenführers der NSDAP. Südwest überbrachte. Ein Triebwagen führte mich am Strand entlang, von dem an mehreren Stellen Tausende von Vögeln aufgeschreckt empor und ins Meer hinausflatterten. Und sie ließen sich auf einer eigenartigen Insel nieder, 500 Meter von der Küste entfernt. Das also ist jene Insel, von der Fachleute sagen: Sie kann gar nicht dastehen, es ist einfach ausgeschlossen. Und sie steht doch, die Guanoinsel im Meer. Und die Theoretiker schielen böse auf das Unding, das nach Zahlenberechnungen nicht dastehen kann und praktisch doch da und einfach nicht wegzuleugnen ist. An dieser Stelle, zwischen Walfischbay und Swakopmund, liegt eine Felsenplatte im Meer, die zur Ebbezeit freiliegt, früher von Tauchern und anderen Wasservögeln bevölkert war, zur Flutzeit jedoch von Wasser überspült wurde, das allen wertvollen Guano, den die Tiere hinterlassen hatten, hinwegschwemmte. Da versuchte ein findiger Mann zur Gewinnung des Guanos eine künstliche Insel auf die Felsenplatte zu stellen. Große Betonpfeiler setzte er auf das Gestein, die aber jedesmal über Nacht von der Flut hinweggeschwemmt wurden. Herr Winter, ein Deutscher, sah sich die Sache an und meinte: "Ich hätte eine andere Idee." Aber man lachte über seinen Plan. Als der fünfjährige Pachtvertrag des anderen abgelaufen war, pachtete Herr Winter selbst den Platz auf fünf Jahre und stellte erst eine Versuchsinsel 4 x 4 Meter nach seiner Idee ins Meer. Und sie hielt. Er vergrößerte sie auf 8 x 8, auf 16 x 16. Und sie hielt. Da stellte er denn eine Insel von 1600 Quadratmeter hin und auch sie stand trotz aller rechnerischen Beweise, daß sie nicht stehen kann. Sie hat bis jetzt den stürmischsten Wellen standgehalten. [109] Winter, von Beruf Tischler, hat sein Werk ohne alle Berechnung, nur aus dem Gefühl heraus geschaffen. Ausgehend von dem Standpunkt, dem Wasser möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, stellte er das Holzgerüst mit der Plattform auf Rundeisen von nur 50 Millimeter im Durchmesser ins Meer. Die ganze Insel steht lose auf dem Felsen. Sie ist in keiner Weise verankert oder in das Gestein eingebaut. Und das ist, was die Sachverständigen in Erstaunen setzt und was sie für unmöglich erklären. Die Brücke müßte nach ihrer Anschauung längst in tausend Trümmern hinweggefegt sein. Der Umstand, daß die Differenz zwischen Ebbe und Flut nur 1,50 bis 2 Meter, im Gegensatz zu 4 Metern in Hamburg beträgt, begünstigte Winters Arbeit. 5 Minuten nach Fertigstellung der Insel ließen sich schon die Vögel darauf nieder. Sie haben sich sehr schnell daran gewöhnt und darauf genistet. Die heutigen Bewohner sind im allgemeinen schon Kinder der Insel. Herr Winter schätzt die Vögel, die seine Insel bevölkern, auf etwa 25 000. Die Ausbeute davon ist im Jahr eine ungefähr 10 Centimeter dicke Guanoschicht, die viel stickstoffhaltiger als anderweitig gewonnener Guano ist. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß der Guano hier nicht mit Sand und Erde vermischt und infolge des Südwester trockenen Klimas nicht so sehr von Regen ausgelaugt wird. "Ich könnte meine Insel um das Zehnfache vergrößern, wenn ich das Kapital dazu hätte. Leider habe ich es nicht. Aber auch das wird noch kommen. Vorerst macht es mir Spaß, trotz allem anfänglichen Gelächter der lieben Mitmenschen die Insel draußen stehen zu haben, als erste und einzige dieser Art." Die Guanoinsel verschwand. In den Wellen draußen tauchten wie niedrige Segel die dreieckigen Flossen von Haien auf; sie tummelten in Mengen und aufgeregt ganz nahe am Strand herum. Hinein fuhr der Wagen in die Dünenhügel, auf denen die Mittagssonne flimmerte und die sich rechter Hand unabsehbar ins Land hineinzogen. Und dann tauchte Swakopmund auf, die deutsche Stadt, im Sand am Meer. In regelmäßigen, schnurgeraden Reihen sind die meist einstöckigen Häuser in den Sand hineingebaut. Holzstege den Häuserreihen entlang ermöglichen einen mühelosen Spaziergang. Wo sie fehlen, ist das Gehen im losen Sand beschwerlich und kolossal ermüdend. Ulkige Pferdebahnen für Waren- und Personenbeförderung durchziehen das Städtchen. [110] Zwischen den Häusern in Höfen und Vorgärten grünt es im gelben Sand. Rührend und beinahe erschütternd wirkt - wenn man von dem üppigen Tropenlande kommt - der Fleiß und die Mühe, mit der jeder Deutsche hier sich sein Blumengärtchen schafft, der Wüste abzwingt und es mit Liebe und Treue pflegt und sich freut über jede Blüte in seinen Holzkisten und Blechkästen. Und er liebt das Land, mit dem er ringt um jedes Pflänzchen, seine Sonne, seine Dürre, Öde und Weite - der Südwester. Und in mir brannte der Wunsch, dieses eigenartige Land und seine Leute näher kennenzulernen. Einst durchwanderten die Väter des heutigen Geschlechtes auf Ochsenkarren, bespannt mit 20 Tieren, das Land. Sie zogen mit Kind und Kegel durch die Namib, die unendliche Wüste, die die Küste vom Steppenlande trennt. Sie zogen im Wüstensande und die Sonne brannte hernieder und der Durst ging in der wasserlosen Weite, immer drohend und mehr als einmal Opfer fordernd, nebenher. Und abends am Lagerfeuer tönte Geheul von Schakalen und nicht selten auch fernes Löwenbrüllen aufschreckend in den Kreis. In der Steppe zogen sie nach Nord und Süd und Ost und besiedelten das Land. Sie zogen Tage, Wochen und oft Monate. Heute aber surrt der Motor, er surrt auch für mich, denn leider hatte ich nicht monatelang Zeit. Im Nu war der Badeort Swakopmund hinter uns, und es schüttelte und rüttelte uns die Eingeweide durcheinander auf der "Wellblechpad", die hineinführt in die Namib. Vor uns war die öde Weite, waren kahle Sand- und Geröllhügel, die die glühende Sonne zurückstrahlten. Der Wagen surrte hinein in die Wüste, nahm Meile um Meile, und vor uns war und blieb die vegetationslose, grell durchglühte Fläche und über ihr der blaue, unveränderliche Himmel und im Hintergrund, in weiter Ferne, in dunstigem Blau und Lila, steiles und schroffes Gebirge. Auf der "Pad" - der Name ist gut, Straße wäre zuviel gesagt - wühlte sich der Wagen mühsam durch den Sand, dann wieder sprang er lustig über kleine Gräben, und wir hopsten mit im Wagen, hoch und nieder und gegen das Verdeck, daß uns der Schädel brummte. Nun ging es hinab, so plötzlich und steil, daß ich glaubte, der Wagen müsse Purzelbaum schlagen, und nach einigen Metern ebenso steil wieder aufwärts. Wir waren in einem "Rivier" (Flußlauf) untergetaucht, das jetzt leer und wasserlos in die Wüstenlandschaft eingeschnitten war. Einmal im Jahre, zur Regen- [111] zeit, kommen sie für Stunden, in seltenen Fällen für ein paar Tage voll Wasser zu Tal, dann aber mit solcher Wucht und Plötzlichkeit, daß sie einfach alles, was ihnen in den Weg kommt, mit sich reißen und daß sich auch Menschen, die sich gerade inmitten dieses Flußlaufes befinden, sich nicht mehr zu retten vermögen. Manches Menschenleben ist ihnen schon zum Opfer gefallen. Heute waren sie trostlos, die wasserlosen, schlängelnden Flußbette. "Na, ein Berliner Taxifahrer würde sich wohl weigern, hier zu fahren", so meinte Herr Meier. "Ich bin in Deutschland, im bayerischen Wald, wahrhaftig auch schon verdammt unebene Wege gefahren, aber hier -" "Ei, Sie fahren selbst? Wollen Sie es einmal probieren?" Fürwitzig griff ich nach dem Steuerrad, umklammerte es krampfhaft und wirklich, ich jonglierte den Wagen hindurch durch den Sand und zwang ihn hinweg über Hindernisse und Riviere, und die Federn ächzten unwillig und knurrten empört. "Langsamer, langsamer", mahnte Herr Meier. Ein Hügel baute sich vor uns auf, und wie Blitze zuckten die brechenden Strahlen der Sonne von ihm. Der ganze Berg gleiste und glitzerte. Südwest, das Land der Diamanten, so ging es mir durch den Sinn. Was sonst konnte so grelle und blendende Blitze schleudern? Aber nein - gewöhnliches Glas hatte in großmannsüchtiger Weise Edelsteinsmanieren nachgeäfft und von ferne auch Effekt hervorzurufen vermocht. Der kleine Berg war ganz mit zerbrochenen Flaschen und Gläsern übersät. Der Schein trügt, wie oft ist es doch bei den Menschen der Fall. Weite und Öde war vor uns und im Hintergrunde blaue Berge. Kein Gräschen, kein Hälmchen im Sand oder Geröll. Wunderliche, runde, gelbe Kugeln lagen hier und dort verstreut im Sand. Man kann vom Auto aus nicht den dünnen, blattlosen Stengel wahrnehmen, an dem sie hängen. Es sind die Tschamas oder Sandmelonen, die den Zug- oder Reittieren als Nahrung dienen, im Notfalle auch den Menschen vom Tode des Verdurstens erretten können. Der Sand in der Weite flimmerte und schien Leben anzunehmen, blaue Flächen wie Seen tauchten auf und verschwanden wieder, die Berge in der Ferne schienen auf- und niederzuschweben im Spiegel der Luft. Und der Wagen stolperte und holperte. "Nicht so schnell!" [112] Vor uns tauchte im Sande ein Gitter auf, und weiße Steine ragten in die Luft. Ein Kriegerfriedhof. Deutsche und feindliche Soldaten schlafen hier vereint in der stillen Namib den ewigen Schlaf. Wir hielten. Ich photographierte und Herr Meier kroch unter den Wagen und kam mit ernstem Gesicht wieder. "Die vordere rechte Feder ist kaputt, beinahe ganz durch." Herr Meier ergriff das Steuer, um nun ganz vorsichtig und langsam weiterzufahren. Ich saß geknickt neben ihm. "Das ist nicht so schlimm", tröstete er, "Federbrüche kommen hier alle Tage vor, und selbst Achsenbrüche sind keine Seltenheit. Solche Dinge und viel schlimmere noch sind hier schon jedem Fahrer passiert. Sehen Sie diese Narbe an meiner Stirn?" "Ja, was ist es damit?" Mit monotoner, vor Hitze, vielleicht aber auch vor Bewegung erschlaffter Stimme erzählte er: "Vor eineinhalb Jahren fuhr ich mit einem Freund durch die Wüste. 'Sieh nur, dort unten ist Rauch, da müssen Menschen sein', so störte mich mein Freund auf und deutete seitwärts. Ich guckte auf und in diesem Moment stürzte der Wagen über das Ufer eines Riviers und überschlug sich. Beide konnten wir uns herausarbeiten. Ich hatte eine klaffende Wunde am Kopf, der Freund klagte über Schmerzen in den Augen und war in größter Sorge um mich, als er mir den Verband anlegen half. Dann aber verspürte er plötzlich Schmerzen im Leib und sank zusammen. Er konnte sich nicht mehr aufrichten. Wir saßen in der Wüste, ohne Wasser, ohne Hilfe. Der Wagen war defekt. Die nächste Farm mochte ungefähr 50 - 60 Kilometer entfernt sein. Da machte ich mich auf, trotz Blutverlust und Schwäche; es galt, den Freund zu retten. Und ich stolperte in die Wüste hinein, während die Sonne höher und höher stieg und ihre Strahlen unbarmherzig auf den Sand brannte. Glutheiße, atemraubende Luft umflirrte mich, und quälender Durst peinigte zum Wahnsinn. Wasser! Doch trockener, glühender Sand nur knirschte unter meinen Füßen, und ich fiel hin - Ruhe -, Schlaf! Der Freund! Der Gedanke scheuchte mich auf und peitschte mich empor, und ich setzte wieder Schritt vor Schritt, unsicher und schwankend, und ein Feuer brannte [113] in meinen Eingeweiden, und die Zunge im Mund wurde schwer. Ich wollte schreien in verzehrender Qual, doch nur ein Lallen kam über meine trockenen Lippen. Und die Nacht brach an, und von ferne winkten Bäume und ein Windrad. Und ich stolperte, fiel hin und raffte mich wieder auf. 200 Meter mochten es noch bis zur Viehtränke sein, deren Wasser mir entgegenspiegelte. Doch ich brach zusammen und kriechend, meterweise, erreichte ich das Wasser. Ich nahm vorsichtig den ersten Schluck, und trotzdem, ich konnte das Wasser nicht behalten. Erst nach längerer Ruhe war ich in der Lage, die Farmersleute zu wecken. Im Donkeymobil (Eselwagen) ging es zurück zur Unfallstelle - der Freund war tot!" Unheimlich still war die Namib um uns, selbst der Motor schien den Atem anzuhalten und leiser zu surren. "Die Namib und die Kalahari, diese Durststrecken, sind nicht nur manchmal den Treckfarmern auf ihren Ochsenwagen zum Verhängnis geworden, sie können sogar dem modernen, im Auto reisenden Menschen noch heute übel mitspielen. Ein Achsenbruch inmitten der Namib - es kommt nicht jeden Tag ein Auto vorüber. Wir sind inmitten der Namib, haben kein Wasser, dafür aber einen Federbruch, wenn sie noch vollständig bricht - es kommt nicht jeden Tag ein Wagen vorüber." Über eine schwarzverkohlte Stelle der Pad führt unser Weg, und daneben liegen die Eisenteile eines verbrannten Wagens. Die Brandspuren sind ersichtlich frisch. Was mag hier vor sich gegangen sein? Wie ein Menetekel erschienen die Spuren in der einsamen Wüste. Vorsichtig fuhr Herr Meier weiter, und die Feder hielt noch immer. Endlich tauchten die ersten schüchternen, trockenen Zweige auf, Erdmännchen huschten über die Pad, und hier und dort flatterte ein Vogel hoch. Es zeigte sich ein bißchen Leben, die schlimmste Durststrecke, die Namib, war hinter uns. Wir erreichten den ersten Ort jenseits der Wüste, Usakos, der hübsch in blaue Berge eingebettet ist. Es war früher Nachmittag; der Wagen mußte zur Reparatur. Wir konnten an diesem Tage nicht mehr weiter. Und ich dachte gar nicht daran, daß an diesem Ort jemand auch nur eine Ahnung von meiner Existenz haben, geschweige denn, mich hier erwarten könnte. Ich kam still und unbeachtet an und wollte ebenso wieder abfahren. Der Zufall aber wollte, daß an diesem Abend im Orte der Potsdamfilm lief. Nur dadurch kam ich mit den Parteigenossen in Usakos in Berührung. [114] Ich wurde lebhaft begrüßt und willkommen geheißen von ihnen, die mich schon seit Monaten erwarteten. Schon bei dem Erscheinen meiner ersten Artikel im SA.-Mann hatte der Landes-Gruppenleiter alle Ortsgruppen von meinem Kommen verständigt und sie angewiesen, mir mit Rat und Hilfe zur Seite zu stehen. Und die lieben Parteigenossen konnten gar nicht begreifen, daß ich schon am nächsten Morgen wieder weiter mußte. Sie wollten mir dieses und jenes zeigen und mich da- und dorthin fahren. Und ich hätte gerne zugesagt. Doch wurde mir nun klar, wenn alle Orte mich schon erwarteten und ich überall mich wochenlang aufhalten wollte, dann würde ich für Südwest allein ein Jahr benötigen. Ich wurde wirklich überall erwartet und freundlich aufgenommen und jeden Tag war etwas anderes los, oder meine Gastgeber wollten von der neuen Heimat hören, und so wurde es spät jede Nacht und für mich sehr anstrengend, aber schön in Südwest. Am nächsten Morgen surrte der Wagen hinein in die Buschsteppe, deren Boden nackt und kahl durch die dürren, blattlosen Büsche leuchtete. Kein Gräschen auch hier, und doch sollte das Weidegrund sein für Vieh, davon zeugten die Umzäunungen, die vielen Tore, die wir zu öffnen hatten. Davon zeugten auch die Farmhäuser, das Windrad und die paar grünen Bäume daneben, die wir, allerdings in vielen Meilen weiten Abständen, passierten. Es war mir unbegreiflich, von was sich das Vieh, das ich tatsächlich hier und dort auf Weide sah, noch nährte. Ich sah im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht ein Gräschen oder Hälmchen. Drei Jahre hat es schon kaum mehr geregnet. Wenn auch dieses Jahr kein ergiebiger Regen kommt, so wird das eine Katastrophe für das Land. Dürr und trocken ist der Busch, und doch, wie ein Wunder ist es: hier und dort grünt eine Giraffenakazie, blüht ein Hackedorn in zarten, weißen Blüten und ein anderer Dornbusch in gelben und sendet seine betäubenden Düfte von sich. Weil es Frühling ist, so müssen sie grünen und blühen, und sie wirken wie kleine Wunder in der Dürre und Öde. Und entgegen einem Spruche, den ich einmal irgendwo gelesen habe, behaupte ich: Und die Vögel Afrikas sie singen - und die Blüten duften doch. Eine Windhose wirbelte plötzlich vor uns auf, hüllte uns ein und trieb uns den Sand sogar in den eilig geschlossenen Wagen. Vor uns wanderten nicht weniger als drei dieser hohen Sandsäulen und tanzten lustig hin und her. Sie sollen das Zeichen für ein gutes Regenjahr sein. Geb's Gott. Mengen von wilden Perlhühnern flüchteten vor uns über den Weg, [115] eine Herde von Straußen verharrte bei unserem unvermuteten Auftauchen erst ruhig hinter Büschen. Als wir hielten, stelzten sie auf langen Beinen in eiliger Flucht davon. Ein vereinzelter Pavian, der aus den trockenen Bergen sich zu einer Viehtränke geflüchtet hatte, suchte Schutz vor unseren Augen hinter einem kümmerlichen Busch. Doch schließlich fühlte er sich nicht mehr recht sicher und stürzte in langen Sätzen fort. Wir erreichten die Hauptstadt Windhuk, die 1700 Meter hoch, wunderschön in Berge eingebettet liegt mit ihren großzügig angelegten Straßen und Geschäften. Aber trocken liegt auch hier die Landschaft, und nur zum Protest und um zu dokumentieren, daß es doch Frühling ist, haben sich eigenwillig einige grünende und blühende Büsche dazwischengemischt. Ich bereiste in Etappen das Land, per Bahn und per Auto, nach dem Osten bis Gobabis, an den Rand der Wüste Kalahari, die, wie im Westen die Namib, hier im Osten das Land abschließt. Und es war dürre, öde Steppe den ganzen Weg. Aasgeier saßen auf den knochendürren Zweigen eines Kameldornbaumes, unter dem ein verendetes Rind lag. Windhosen stiegen hoch empor, bis tief in den Himmel. Luftspiegelungen täuschten blaue Seen vor. Ein wunderbarer Vogel im farbenprächtigen Kleid des Schmetterlings flatterte lange vor uns her, und ein einsamer Adler saß auf einer Telefonstange. Und ich war im Norden, an der Grenze des Landes, dort wo die Termitenhügel so dicht wie gesät aus dem Boden sprießen, wo die wunderlichen Gesellschaftsvögel ihre Städte in die nackten Zweige der Bäume bauen und bis zu 60 und 80 nebeneinander wohnen. Ob es bei diesem nahen Beisammensein, so Schwelle an Schwelle, nicht stört und den Neid erweckt, wenn die Frau Nachbarin ihr Gefieder besonders fein geputzt hat? Ob es in dieser Stadt auch Zank und Streit und Buschklatsch gibt? Dort oben im Norden sah ich zum ersten Male an einigen Strecken hohes trockenes Silbergras, Weideplätze. Aber sie sind nicht abzuweiden. Es fehlt das Wasser in erreichbarer Nähe zur Viehtränke. Hier ist noch Gras, und anderswo verhungern die Tiere und verkommen, tausendstückweise. Es ist heute so im Lande: Wo es noch Gras gibt, dort ist kein Wasser, und wo Wasser ist, dort ist kein Gras mehr. Ich war auch ein Stück im Süden, dort wo die Dürre am kritischsten ist, wo das Rind sich in den Schatten einer Telefonstange legt, wo drei zusammenstehende Kameldornbäume schon für eine englische Parklandschaft angesehen werden. Das ganze Land, über dem die sengende Sonne brennt, durstet und [116] schreit nach Wasser. Die Farmer blicken mit sehnsüchtigen Augen nach dem Horizont, wenn kleine Wölkchen auftauchen. Regen, Wasser - und das Land ist ein Paradies, ein zweites Kalifornien. Es ist ein hartes Land und hat sich ein hartes und starkes Geschlecht herangezogen. Ich spreche nicht von den Eingeborenen noch von den fremden Eindringlingen, die im Kriege hereingekommen sind, sondern von jenen, die das Land erschlossen, die es verteidigt, die es aufgebaut haben und die deutschen Blutes sind. Und sie lieben ihr Land, um das sie ringen, dessen Bestand sie mit Zähnen und Nägeln verteidigen. Sie lieben seine Weite, seine Sonne, seine Härte. Es ist jeder einzelne ein kleiner König in seinem Reich. Sie kennen nicht die Enge der Heimat. Eineinhalbmal so groß wie Deutschland beherbergt es nur etwa 30 000 Weiße. Hier ist Luft und Raum und Licht. Und ist das Land auch hart und bringt es durch jahrelange Trockenheit, durch Heuschreckenschwärme, durch Viehseuchen Not und Elend und Kummer und Sorgen, so kann es doch auch so freigebig, so verschwenderisch sein und durch ein einziges regenreiches Jahr allen Schaden wieder gutmachen. Deshalb lieben die Südwester ihr Land auch heute noch, so trocken es ist. Es hat sie gepackt und läßt sie nicht mehr los. Und wenn sie nach Deutschland kommen, so halten sie es dort nicht mehr aus, es zieht sie unwiderstehlich nach hier zurück und sei es selbst in eine ganz ungewisse Zukunft. Und kommen sie wieder in das Land und würden sie sogar vom blühenden Frühling Deutschlands kommen, so ist jeder kärglich blühende Kameldorn wie eine Offenbarung, wie ein herrliches Wunder für sie. Es ist ihr Land, sie lassen es sich nicht nehmen. Deutsch ist es, von Deutschen aufgebaut, Deutsche haben ihr Blut vergossen dafür, und ihre Gräber sind im Lande verstreut. Deutschsüdwest den Deutschen!
|