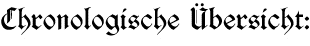|
[Bd. 5 S. 504]
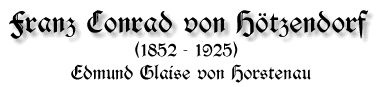
Der Feldmarschall hat am 11. November 1852 zu Penzing – damals noch ein zwischen Wiese und Wald geborgener Vorort von Wien – das Licht der Welt erblickt. Sein Vater war Husarenoberst und entstammte einer deutsch-mährischen Beamtenfamilie. Der Hauptname war Conrad. Das Adelsbeiwort Hötzendorf, das der Großvater erworben hatte, leitete sich von dem Namen eines pfälzischen Geschlechtes her, dessen letzter weiblicher Sproß Conrads Urgroßmutter gewesen ist. Es fehlte also auch ihm der so vielen Österreichern eigene Tropfen reichischen Blutes nicht. Conrads Vater hatte als junger Offizier an den Freiheitskriegen teilgenommen und mit seiner Schwadron einen Tag lang Napoleon auf der Fahrt nach Elba vor den Anfechtungen durch seine südfranzösischen Landsleute geschützt. Die Folgen eines Sturzes mit dem Pferde nötigten Anno 1848 den alten Reitersmann, den aktiven Dienst zu verlassen. Drei Jahre später heiratete er die Wienerin Barbara Kübler, Tochter und Schwester angesehener Maler, durch die Künstlerblut in die Adern des Feldmarschalls kam. Von den beiden Eltern nahm, wie es scheint, die Mutter größeren Einfluß auf das Werden und Wachsen des Sohnes. Bei der Wahl des Berufes drang allerdings der Vater durch. Der Knabe wurde mit elf Jahren ins Hamburger Kadetteninstitut gesteckt, aus dem er 1867 in die Neustädter Militärakademie, die berühmteste Pflanzstätte des alten kaiserlichen Heeres, aufstieg. Hatte der junge Kadett von Hamburg aus die letzten Schüsse des Bruderkrieges – Gefecht bei Blumenau – verhallen gehört, so verfolgte er im letzten Akademiejahre heißen Atems die Geschehnisse auf dem französischen Kriegstheater. Zu seinen Klassenkameraden gehörten Auffenberg, [505] der spätere Sieger von Komarow, und Georgi, der langjährige nachmalige Minister für Landesverteidigung. 1871 zum Leutnant im 11. Feldjägerbataillon ernannt, ging Conrad schon in dem noch "höchst bescheidenen Wirkungskreis" eines Rekrutenausbildners daran, bei den großen Lehrmeistern des deutschen Heeres in die Schule zu gehen. "Die Schriften von Boguslawski, Scherff, Hellmuth, May, Tellenbach, Verdy du Vernois, Kühne, dann später Hoenig, Natzmer und vielen anderen", schreibt er, "ließen mich bald die neuen Wege erkennen... Das Wesentlichste lag dabei in der Ausbildung für den Kampf, das Gefecht, und zwar insbesondere der Ausbildung in geöffneter Ordnung... Für die Methode der Ausbildung gab eine Schrift Waldersees wertvolle Richtlinien." Auf der Kriegsschule, die der deutschen Kriegsakademie entsprach und die Conrad in den Jahren 1874–1876 besuchte, wurde insbesondere der Einfluß bedeutsam, den Johann Freiherr von Waldstätten, für ein Menschenalter taktischer Lehrmeister des kaiserlichen Heeres, auf die militärische Geistesrichtung seiner Schüler nahm. Im Generalstabstechnischen waren es vor allem die Schriften des österreichischen Generals Gallina, denen Conrad zeitlebens maßgebende Wirkung auf sein Denken zuschrieb. Eingehende Beschäftigung mit der Kriegsgeschichte geleitete den Feldmarschall auf den Gipfel seiner Laufbahn; sie wurde ergänzt durch Schlachtfelderreisen nach Frankreich und auf den Balkan, die in "69 Landschaftsskizzen von Gefechtsfeldern der Jahre 1870/71 – 1876/77 – 1885" ihren wissenschaftlich-künstlerischen Niederschlag fanden. Die durch freiwillige Meldung erreichte Teilnahme an der Besetzung Bosniens und des Limgebietes (1878/79) und an der Niederwerfung eines Aufstandes in Süddalmatien ließen den nun schon in den Generalstab eingereihten Offizier den Krieg zwar noch nicht in seinen großen Abmessungen, aber doch mit seinen körperlichen und seelischen Anforderungen kennen lernen. In Erinnerung an die ersten, grausam verstümmelten Gefallenen, die man bei Doboj vor seinen Augen begrub, schreibt er 47 Jahre später die sein Denken kennzeichnenden Worte: "Dieser Anblick ließ mich völlig kalt, und ich sah, daß ich über jene Härte verfügte, die in meinem Berufe unerläßlich ist: eine Härte, nicht dem Mangel an Gemüt oder Teilnahme, sondern der Überzeugung von der Unerbittlichkeit des Kampfes ums Dasein, des mit ihm innig verbundenen, unaufhaltsamen historischen Geschehens und der daraus für den einzelnen erwachsenden Pflichten entspringend." In der Armee machte Franz von Conrad frühzeitig von sich zu reden. Wenn er in den achtziger Jahren als zierlicher Generalstabshauptmann mit schlotterndem Waffenrock und seinen Kriegsauszeichnungen im Gefolge des Generals Prinzen Lamoral Taxis erschien, da ging schon ein Raunen durch das Offizierkorps des Lemberger Generalats: "Von dem wird man noch zu hören bekommen." Sein Wirken als Taktiklehrer an der Kriegsschule – seine Schüler von damals sollten im Weltkriege seine Divisions- und Korpsführer sein – schuf ihm eine Gemeinde von begeisterten, bedingungslos ergebenen Anhängern, die ein [506] Jahrzehnt später noch durch kurzes Wirken in einem Kursus für angehende Stabsoffiziere erheblich vermehrt wurden und seinen Ruhm in die entlegensten Standorte des Reiches trugen. Conrad war eine außerordentlich angenehme, helle Stimme eigen. Aber eine Rednergabe, im landläufigen Sinne, besaß er nicht; wie er denn auch – im Salon und im Kameradenkreise der liebenswürdigste Sprecher – zeitlebens nur mit größtem Widerwillen als Redner auftrat. Er nahm seine Schüler nicht durch schwungvolle Phrasen gefangen, sondern durch Ideenreichtum, Ursprünglichkeit des Denkens und die Fähigkeit, schwierige Schlußfolgerungen in verblüffend einfache Formeln zu gießen. Diese Eigenschaften bewährten sich auch, als Conrad zuerst als Bataillonsführer und dann in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre als Kommandant des berühmten sudetendeutschen Regiments Kaiser Nr. I wieder in die Front zurückkehrte. Der Arbeit am grünen Tisch im Grunde genommen wenig zugeneigt, erklärte er später immer wieder die Zeiten der Regimentsführung für die schönsten seiner Laufbahn. Die Früchte seines Wirkens an der Kriegsschule hatte Conrad durch sein zweibändiges Lehrbuch Zum Studium der Taktik (1891) einem breiteren Kreise vermittelt. Auch drei Hefte Taktikaufgaben hatte er, angeregt nicht zuletzt durch Verdys Studien über Truppenführung, erscheinen lassen. Nun folgte, nachdem er seine Ausbildungsweise bei der Truppe erprobt hatte, wieder unter den Deckbuchstaben F. C. v. H. eine Studie über Die Gefechtsausbildung der Infanterie (1900), die des Verfassers Ansehen und Geltung im internationalen Militärschrifttum noch gewaltig vermehrte. Franz Conrad war mittlerweile schon Generalmajor und Brigadekommandant in Triest geworden. Während der Kommandoführung auf diesem heißen Posten brach unter den Hafenarbeitern ein Ausstand aus, der gefahrdrohenden Umfang annahm. Der Brigadebefehlshaber erwies sich bei der Unterdrückung als Mann von Entschlossenheit und Tatkraft. Hatten ihn schon hier die Beziehungen zwischen dem Habsburgerreich und Italien nachdenklich gemacht, so bot sich ihm nach seiner Ernennung zum Divisionskommandanten in Innsbruck nunmehr mannigfaltigere Gelegenheit, an der Abwehr der aus dem Süden heraufziehenden Gefahren mitzuwirken. Das Werden eines modernen Verteidigungsgürtels an den Gemarkungen Tirols und die Schaffung eines Grenzschutzes, dessen Rückgrat die zu einer Elitetruppe ausgestalteten Landesschützen wurden, waren mit sein Werk. Die Ausbildung, die er seinen Truppen im Gebirgskriege zuteil werden ließ, wurde für alle Armeen vorbildlich. Er forderte viel von Offizier und Mann, aber auch von sich. Begeisterter Freund der Gebirgswelt und ausdauernder Bergsteiger, machte er alle Mühsale und Anstrengungen der Truppe mit, deren Nachtlager auf irgendeiner Alpenweide oder Felshalde der angehende Fünfziger, in seinen Offiziersmantel gehüllt, ohne Zaudern teilte. Inzwischen war auch der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand längst auf Conrad aufmerksam geworden. Er hatte sich ihn 1904 zu den im letzten Augen- [507] blick wegen Dürre abgesagten Manövern als Armeegeneralstabschef ausbedungen und setzte nun zwei Jahre später, im November 1906, beim Kaiser durch, daß der General an Stelle des greisen Grafen Beck an die Spitze des Generalstabes der gesamten bewaffneten Macht berufen wurde. Conrad vertauschte den ihm so lieb gewordenen Tiroler Wirkungskreis höchst ungern mit dem neuen, dornenvollen Amte. Aber einmal auf seinen Posten gestellt, wandte er sich mit einem wahrhaft josefinischen Reformeifer den neuen Aufgaben zu, die bei dem Stillstand, der dem Heer ein Jahrzehnt hindurch zweifellos beschieden gewesen war, bei den unerhörten kriegstechnischen Fortschritten der Zeit und bei dem unverkennbar einsetzenden Wettrüsten der anderen Großmächte an Umfang und Schwere nichts zu wünschen übrig ließen. In den Kämpfen um die Armeeverstärkung wurde der neue Generalstabschef der hervorragendste Rufer im Streite, bis es endlich 1912 dem Ministerpräsidenten Stefan Tisza in Ungarn gelang, das neue, allerdings schon wieder unzulängliche Wehrgesetz durchzudrücken und diesem damit auch den Weg im österreichischen Parlament frei zu machen. Die Infanterie erhielt, wenn auch lange nicht in ausreichender Zahl, ein tragbares Maschinengewehr. Die Artillerie bekam eine neue Feldkanone, und mit nie erlahmendem Nachdruck wies der Generalstabschef immer wieder auf die Bedeutung des Steilfeuergeschützes und mittlerer und schwerer Artillerie im künftigen Kriege hin. Auch bei der Schaffung des 30,5-cm-Mörsers, der im Sommer 1914 vor den belgischen Festungen seine Feuertaufe erhielt, stand er Gevatter. Gewiß zog das kaiserliche Heer mit einer noch immer sehr unzulänglichen artilleristischen Rüstung in seinen letzten Kampf; daß dem so war, war jedoch wahrlich zu allerletzt Schuld des nimmermüden, lästigen Mahners Conrad. Gleiche Aufmerksamkeit wandte er der Ausgestaltung der technischen Truppen und des Nachrichten- und Verbindungswesens zu. Auf dem Gebiete der Luftschiffahrt stellte er schon um 1910 ein Programm auf, das prophetisch auf die Bedeutung der neuen Waffe, zumal des Flugwesens, für den künftigen Krieg hinwies. Auch in der Ausbildung des Heeres beschritt Conrad vielfach neue Bahnen. Äußerlichkeiten der alten Exerzierschule fanden in ihm einen unerschütterlichen Verächter. "Unter allen Zweigen der Truppenausbildung nimmt", läßt er sich in einer seiner Schriften vernehmen, "jener für das Gefecht, als entscheidender Akt im Kriege, weitaus die erste Stelle ein... Zur Pflege von bloßen Äußerlichkeiten hat die heutige Infanterie keine Zeit." Diesem seinem Streben versuchte er auch in den Ausbildungs- und Gefechtsvorschriften zum Durchbruch zu verhelfen, wobei er allerdings – vielleicht zum Nutzen der Manneszucht – nicht immer völlig obsiegte. Der Angriffsgeist, den er der Truppe einhauchte und der dieser namentlich zu Kriegsbeginn auch manches überschwere Opfer auflud, gehörte mit in dieses Kapitel seines Wirkens. Die großen Übungen trachtete er, indem er sie durchlaufend ausführen ließ, möglichst kriegsmäßig zu gestalten. [508] Unter diesem Gesichtspunkte fanden die gleichzeitigen reichsdeutschen Manöver bei ihm, so warm er das deutsche Wehrwesen sonst schätzte, mitunter einen nicht immer nachsichtigen Kritiker. Dem Völkerheer Österreich-Ungarns sein moralisches Gefüge zu sichern und den nationalen Hader, der die Monarchie durchrüttelte, von ihm fernzuhalten, galt sein heißestes Bemühen. Ungarns Streben nach militärischen Sonderrechten oder gar nach einer Teilung der gemeinsamen Armee stieß bei ihm jederzeit auf den entschiedensten Widerstand, da er in der Wehrmacht das stärkste Bollwerk des Habsburgerreiches sah und auch vermieden wissen wollte, daß durch Zugeständnisse an die Magyaren die Begehrlichkeit anderer Völker erweckt würde. Im Juli 1914 im Rate der Krone noch einmal vor die Frage gestellt, zwischen Krieg und Frieden zu wählen, sprach sich der General nicht zuletzt deshalb für die kriegerische Lösung aus, weil er sich des Heeres in nationaler Hinsicht noch sicher zu wissen glaubte, aber Zweifel hegte, daß es auch in Zukunft so bleiben werde. Als im Kriege an der Front zusehends nationale Schwierigkeiten fühlbar wurden, war er der letzte, dieses Übel zu beschönigen; bewegte Klagen darüber finden sich in seinem Nachlaß. Aber das Urteil, das er lange nach dem Umsturz fällte, war doch dieses, daß vergleichsweise "keine andere Armee Größeres... geleistet habe" als die, die er ins Feld geführt hatte. Seine Rolle als Mahner und Dränger trug dem Generalstabschef mancherlei Gegnerschaft ein. So erblickte der Kriegsminister Schönaich in den Forderungen Conrads allgemach unerfüllbare Wünsche eines "Phantasten", deren Vertretung vor den Parlamenten erst gar nicht in Frage kam. Franz Ferdinand stellte sich auf die Seite des Generalstabschefs. Er erzwang im Herbst 1911 den Sturz des Kriegsministers, der durch Auffenberg ersetzt wurde. Weniger erfolgreich verlief für Conrad der Kampf mit seinem zweiten mächtigen Gegner, dem Außenminister Aehrenthal. Conrad hatte seit seinem Amtsantritt mit wachsender Sorge die Einkreisungspolitik der Welt gegen die Mittelmächte verfolgt und die Auffassung vertreten, daß Österreich-Ungarn der drohenden Gefahr völliger Umschließung nur durch einen Vorbeugungskrieg zu entgehen vermochte. "Das Bündnis mit Deutschland", heißt es in seinen Denkwürdigkeiten, "galt mir als fest und unverrückbar, weil ich der deutschen Treue sicher war schon deshalb, weil Kaiser Wilhelm für sie bürgte; auch entsprach das Bündnis... den Interessen der beiden Reiche." Dagegen erblickte er "in Italien unter allen Umständen den Feind" und verglich den Dreibund mit einem "dreibeinigen Tisch, der umfallen muß, sowie eines der Beine versagt". Dem für eine kriegerische Verwicklung als selbstverständlich angenommenen Abfall Italiens durch einen Gegenzug zuvorzukommen, hielt der Generalstabschef für ein unverrückbares Gebot österreichisch-ungarischer Politik. Er trat schon im Sommer 1907 für einen Angriff auf Italien ein und sprach namentlich auch während des Tripoliskonfliktes (1911) scharfem Vorgehen gegenüber dem südlichen Dreibundgenossen [509] das Wort. Neben Italien war Serbien die Sorge seiner Tage und Nächte. Daß die Annexionskrise (1908/09) nicht durch das Schwert gelöst wurde, bereitete ihm die größte Enttäuschung; der diplomatische Erfolg des Wiener Kabinetts war ihm – nicht zu Unrecht – ein Pyrrhussieg. Die Einverleibung Serbiens galt ihm als Vorbedingung für eine glückliche Lösung der so brennenden südslawischen Frage; gemeinsam mit Serbien wären dann sämtliche südslawischen Gebiete der Monarchie zu einem dritten Staate der Habsburgerkrone zu vereinigen gewesen. Der Außenminister empfand jeden Versuch des Generalstabschefs, in außenpolitischen Angelegenheiten mitzureden, als unstatthafte Einmengung. Andererseits durchkreuzte er selbst, indem er in Fragen der Grenzbefestigung, der Truppenverstärkungen an der Grenze und des militärischen Kundschaftsdienstes Rücksichten der Außenpolitik über militärische Notwendigkeiten gestellt wissen wollte, die Bahnen des Generalstabes. Über diesem Kleinkrieg erhob sich der grundsätzliche Gegensatz der beiden Männer in der Frage des Vorbeugungskrieges zu entscheidender Schicksalhaftigkeit, und Aehrenthal fand bei der schärfsten Ablehnung der Gedankengänge Conrads einen mächtigen Gesinnungsgenossen in Kaiser Franz Joseph. Im Sommer 1911 steigerte sich der Zwiespalt zwischen Generalstab und Ballhausplatz zur Unerträglichkeit; sein Ausgang aber war fast sicher. Als im November darauf während der Tripoliskrise Conrad neuerlich scharfe Schritte gegen Italien empfahl und sich dabei über Aehrenthal beschwerte, fuhr der greise Herrscher erbittert auf: "Die Politik mache ich, das ist meine Politik." Wenige Tage später wurde Conrad von der Leitung des Generalstabes abberufen und mit einem Armeeinspektorat betraut, was zugleich die Vorbestimmung für ein Armeekommando im Kriegsfalle bedeutete. Der Thronfolger war im Herzen zwar gleichfalls dem Gedanken eines Vorbeugungskrieges durchaus abgeneigt; man dürfe, schrieb er zu Beginn der Annexionskrise, der Monarchie solche "Kraftstückel" nicht zutrauen und möge in diesem Sinne auch auf den "guten Conrad" einwirken. Dennoch ergriff er im Kampfe gegen Aehrenthal unzweideutig für den Generalstabschef Partei. Er war es denn auch, der ein Jahr darauf, im Dezember 1912, mitten in der zweiten Balkankrise – Aehrenthal war inzwischen an Leukämie gestorben – die neuerliche Berufung Conrads an die Spitze des Generalstabs erreichte. Ein britisches Blatt schrieb damals, daß dieser Entschluß des Kaisers eine starke Armee wert sei. Wieder setzte Conrad in den folgenden Monaten alles daran, Österreich-Ungarns Eingreifen auf dem Balkan zu erzwingen, wobei er gleichzeitig das politische Ziel verfolgte, Rumäniens Freundschaft zu erhalten und Bulgarien an die Seite des Dreibundes zu ziehen. Aber schon stellte sich der Thronfolger deutlicher in die Front derer, die – mit dem Kaiser an der Spitze – solchen Plänen abermals widerrieten, und gleichzeitig zeigte sich der Erzherzog gegenüber dem Generalstabschef auch in militärischen Dingen nicht mehr so gefolgsfreudig wie früher. [510] Die Anforderungen, die Conrad bei den "freizügigen" Manövern an die Truppe stellte, waren dem Prinzen zu groß; man brauche die Truppe das Sterben nicht erst zu lehren, konnte man ihn tadeln hören. Bei den Herbstmanövern 1913 durchkreuzte der Erzherzog das Konzept des Generalstabschefs ohne dessen Vorwissen durch neue Anordnungen. Andererseits legte ihm der Generalstabschef auf Äußerlichkeiten und eine stramme Exerzierschule zu wenig Gewicht. Auch an der Art, wie Conrad den Generalstab leitete, hatte Franz Ferdinand mancherlei auszusetzen. Den Verrat des Generalstabsobersten Redl führte der Erzherzog nicht zuletzt auf das geringe Interesse Conrads an Personalfragen zurück. In edler Selbsterforschung schrieb der Feldmarschall ein Jahrzehnt später: "Was aber die Menschenbeurteilung im allgemeinen anbelangt, muß ich die vorstehenden Darlegungen allerdings dahin ergänzen, daß ich an die Menschen von Haus aus zu vertrauensvoll herangetreten bin und diesen mir oft gewordenen Vorwurf hinnehmen muß." Zudem trat auch im persönlichen Verhältnis zwischen Franz Ferdinand und Conrad manche Trübung ein, woran Gegensätze auf dem Gebiete der Weltanschauung – der Erzherzog war ein strenger Katholik, der Generalstabschef ein Freigeist – keinen geringen Anteil hatten. Das Jahr 1913 war schon voll von schweren Krisen, deren Hochspannung bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Leipzig auch dem Deutschen Kaiser und seinem Generalstabschef Moltke offenbar wurde. Erst in den letzten Monaten vor dem Kriege trat eine leichte Besserung in den Beziehungen ein. Trotzdem wäre Conrads Bleiben kaum mehr von Dauer gewesen. "Im Kriege", sagte Conrad später einmal in humorvoller Übertreibung zur Kennzeichnung seines Verhältnisses zum Thronfolger, "hätte mich der Erzherzog spätestens nach der zweiten Schlacht von Lemberg füsilieren lassen." Da löste die Katastrophe von Sarajevo den gordischen Knoten. Die Voraussagen, die Conrad von Hötzendorf nach dem Einlangen der Unheilsbotschaft stellte, waren nichts weniger als überschwenglich. "Es wird ein aussichtsloser Kampf werden", schreibt er an seine spätere zweite Frau, "dennoch muß er geführt werden, da eine so alte Monarchie und eine so glorreiche Armee nicht ruhmlos untergehen können; so sehe ich einer trüben Zukunft und einem trüben Ausklingen meines Lebens entgegen." Trotzdem fühlte er sich, um die Erfolgsaussichten eines Krieges befragt – wie schon erwähnt – verpflichtet, wieder für einen solchen zu sprechen – in der Überzeugung, daß die Zukunft außen- und innenpolitisch kaum eine Besserung, weit eher eine Verschlechterung bringen werde. Das große Ungemach brach über die Welt herein, und Pflichten, schwerer als sie je ein Mensch zu tragen gehabt hatte, sanken auf die schmächtigen Schultern Conrads nieder, dem – neben dem nie aus seiner bescheidenen Zurückhaltung heraustretenden, ritterlichen Oberbefehlshaber Erzherzog Friedrich – die Leitung der Kriegshandlungen verantwortlich zufiel. [511] Beim Betrachten von Conrads Feldherrnwirken stellt sich von Anbeginn eine hervorhebenswerte Beobachtung ein. Im Frieden war bei ihm das Interesse an den Fragen der höchsten Führung in der Regel hinter der liebevollen Befassung mit den Geschehnissen auf der Walstatt zurückgetreten. Wann immer er ein Kriegsspiel zu leiten hatte, fast immer drängte er aus der Welt der großen Strategie auf das Schlachtfeld hinaus. Als Franz Ferdinand in seinem letzten Lebenswinter endlich auch das Auftreten von Millionenheeren vor der hohen Generalität behandelt wissen wollte, leistete der Generalstabschef eingestandenermaßen nur ungern Folge. Auch sein literarisches Wirken bewegte sich in diesen Bahnen. Dennoch sollte, als es Ernst ward, der Stern der Begabung Conrads am hellsten gerade in den Bezirken der größten Führung leuchten: im Erkennen der höchsten militärpolitischen und strategischen Zusammenhänge, im Herausfinden der verwundbarsten Stellen des Gegners, in der raschesten Einfühlung gegenüber den entscheidenden Wendungen der Kriegslage – voll Meisterschaft in der Kunst der Aushilfen, als die der große Moltke, von Conrad verehrt wie kein zweiter Feldherr der Vergangenheit, die Strategie bezeichnet hat. Festgeformte Thesen, wie wir sie bei Clausewitz, Moltke, Schlieffen finden, hat Conrad von Hötzendorf auf dem Gebiete der Kriegswissenschaften nicht hinterlassen. Dazu war er – bei aller Hochschätzung dieser Wissenschaften und vor allem der Kriegsgeschichte – viel zu sehr der auf der Erfahrung fußende Praktiker. Wie er in den Jahren 1907 bis 1914 die politisch-militärische Handlungsfreiheit durch einen Vorbeugungskrieg behauptet wissen wollte, so zog er als Feldherr den Angriff fast bedingungslos der Abwehr vor, weil nur der Angriff dem Feinde das Gesetz des Handelns aufzwingen konnte. In der großen Heerführung strebte er, wenn irgend möglich, die Umfassung des Gegners oder Flügelangriffe an, auf dem Schlachtfelde bevorzugte er das Vorgehen aus zwei Fronten, während er von Schlieffenschen Umgehungsmanövern wegen der Schwere ihrer Ausführung weniger hielt. Ebenso verhieß ihm der Durchbruch geringere Entscheidungsmöglichkeiten, wenn ihn auch die Kriegslage immer häufiger dazu zwang, diesem Kampfverfahren in seinen Erwägungen den maßgebenden Platz einzuräumen. In dem gewaltigen Durchbruch von Gorlice, an dessen Erfolg er so entscheidenden Anteil hatte, sah er fürs erste mehr eine örtliche Entlastung der Karpathenfront, während ihm nach wie vor eine wirkliche Niederwerfung Rußlands nur durch ausholende Flügelangriffe erreichbar zu sein schien. Das Streben, aus dem Durchbruch heraus möglichst rasch zu schärfster Umfassung aufgerissener Feindflanken zu gelangen, veranlaßte ihn im Mai 1916 zu dem Versuche, der Durchstoßgruppe eine ganze Armee geschlossen im zweiten Treffen folgen zu lassen. Bei der Vorbereitung von Angriffshandlungen erstrebte er grundsätzlich – vereinzelte Ausnahmen wie in den ersten Kämpfen, in denen die Kräfteverteilung zwischen Nord und Süd, rein militärisch betrachtet, nicht glücklich zu heißen war, bestätigen die Regel – die Zusammenfassung aller irgendwie [512] verfügbaren Kräfte in oft vorbildlicher Weise unter weitgehender Entblößung der nicht entscheidungverheißenden Fronten. In der reinen Abwehr sah er zu allen Zeiten nur ein notwendiges Übel. Der stehende Flankenschutz, den sich im Jahre 1915 der Stoß Mackensens auf Brest-Litowsk gegen Osten und Südosten gab, errang schwer seinen Beifall. Selbst zum Beziehen des Isonzowalles entschloß er sich höchst widerwillig erst auf Drängen Falkenhayns, der ihm die Beistellung der Kräfte zu einem Angriff auf den abgefallenen Dreibundgenossen versagte. Nachdem er aber den Entschluß, am Isonzo einer zuerst erdrückend und auch später immer beängstigend großen Überlegenheit die Stirne zu bieten, gefaßt hatte, hielt er an ihm allerdings mit zäher Beharrlichkeit fest. Wie ihm ja überhaupt neben hoher Geistigkeit auch die wichtigsten ethischen Eigenschaften wirklichen Feldherrntums in reichem Ausmaße mitgegeben waren: großes Wollen, unbeugsame Zähigkeit in der Durchführung, Verantwortungsfreudigkeit, Kühnheit im Wägen und Wagen, beispiellos starke Nerven trotz einer ausgesprochen pessimistischen Grundeinstellung zu den Dingen. Nach der ersten Schlacht bei Lemberg klagte er in einem Briefe, daß "sein Stern gesunken..., sein Schicksal besiegelt..." sei. Dennoch wird immer wieder mit Recht auf die unerhört starke Nervenprobe verwiesen, die er zehn Tage später, während sein deutscher Kamerad, der jüngere Moltke, an der Marne einen schon greifbaren Erfolg fallen ließ, in der zweiten ostgalizischen Schlacht abgelegt hatte: er brach sie erst ab, als sich schon eine ganze feindliche Armee in die Lücke zwischen den Streitkräften der Generale Dankl und Auffenberg, in den Rücken der kämpfenden Hauptfront eingezwängt hatte. Gewiß glaubt die Kritik der Conradschen Kriegführung auch Schwächen nachsagen zu müssen: daß seine gewaltigen Ideen mitunter der nötigen Erdenschwere entraten hätten; daß er bei der Durchführung seiner hochbeschwingten Pläne nicht immer dem Zusammenspiel von Raum, Kraft und Zeit vollendet Rechnung getragen; daß er die abwehrende Wirkung der modernen Feuerwaffen zu wenig anerkannt; daß er seiner Armee nicht selten viel, viel Schwereres, als er nach der Lage fordern durfte, zugemutet habe. Sicherlich sind auch die größten Feldherrn der Geschichte vor dem Schicksal nicht gefeit gewesen, in einem oder dem anderen Augenblick ein Stirnrunzeln des Kriegsgottes herauszufordern, und je länger der einzelne die trügerische Kunst geübt hatte, umso leichter lief er diese Gefahr. Conrad stand unter allen Generalstabschefs des Weltkrieges am längsten auf diesem verantwortungsvollen Posten, war also auch am längsten den Launen des Gottes der Schlachten ausgesetzt, der sich von ihm überdies jeden Erfolg nur äußerst mühsam und unter harten Krisen abringen ließ. Aber welch strenge Sonde man immer an Conrads Feldherrnwirken anlegen mag – die Hauptstationen seiner Feldherrnlaufbahn sind von geschichtlicher Größe. Entgegen allen ernsten und unernsten Kritiken haben sich die Grundgedanken seines ersten russischen Feldzuges nachträglich doch als im Wesentlichen richtig [513] erwiesen; nicht zu Unrecht erinnert die österreichische amtliche Darstellung daran, wie der russische Krieg später, in den Jahren 1915 bis 1918, wenn auch keuchenden Schrittes, so doch durchaus den großen Linien gefolgt ist, die ihm Conrad im August 1914 von seinem Przemysler Hauptquartier aus und nachher stets aufs neue abgesteckt hat – bis zur Eroberung von Kiew und Odessa hinaus! Vorbildlich erwies sich der Wagemut, mit dem er im November 1914, dem großen Plane der deutschen Ostfeldherren sich anpassend, die Hauptmasse seines Heeres zur Deckung Deutschlands nördlich von Krakau ansetzte, während er die Sicherung der Wege nach Budapest und Wien untergeordneten Kräften überließ. Erstaunliche Zähigkeit verriet er, wenn er im Jahre 1914 seine Armeen den russischen Bären dreimal anspringen ließ und kurz darauf aus den winterlichen Karpathen mit schon stark gelichteten und zum Teil auch wankenden Reihen noch ebensooft. Daß dieser Karpathenkrieg den Truppen Übermenschliches auch dann noch auflastete, als der Erfolg schon höchst zweifelhaft war, soll nicht geleugnet werden; aber er hat doch die Vorbedingungen zu dem Vergeltungsschlag von Gorlice geschaffen. Im Sommer 1915 hat dann der Feldmarschall die Vernichtungspläne Hindenburgs immer wieder aufs wärmste gegenüber der Falkenhaynschen Zermürbungsstrategie vertreten. Bei der Niederwerfung Serbiens im darauffolgenden Herbst hätte das von ihm gewünschte weitere Ausholen der in Bosnien angesetzten und der bulgarischen Streitkräfte zu einer völligen Vernichtung des Gegners führen können. Und wenn der Deutsche Generalstab nachher den Vorschlag Conrads, nun auch die Entente aus Saloniki zu vertreiben, unter dem Hinweis auf die zweifellos bestehenden technischen Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens ablehnte, so boten die Ereignisse beim Zusammenbruch, der bekanntlich von der Balkanfront her seinen Anfang nahm, rückblickend doch schwerwiegende Argumente zugunsten der Auffassungen Conrads. Ebenso wird die reichsdeutsche Militärliteratur, wenn sie in den immer wiederkehrenden Offensivplänen Conrads wider Italien vor allem Äußerungen einer Gefühlspolitik zu erblicken geneigt ist, den Tatsachen doch nicht ganz gerecht, wenn man der Rolle gedenkt, die das apenninische Königreich im Lager der Entente zunächst vor allem politisch und gegen Ende doch auch militärisch gespielt hat. Nicht zum wenigsten verdient der letzte dieser Offensivpläne Conrads Beachtung, den er kurz vor seinem Sturz als Generalstabschef, im Jänner 1917, dem deutschen Hauptquartier überreichen ließ. Wenige Wochen, nachdem dieser Vorschlag erstattet worden war, fiel die französische Armee nach den mißglückten Frühjahrsangriffen schweren Ausschreitungen und Meutereien anheim; malte der britische Premier Lloyd George seinen Landsleuten wegen der deutschen U-Boote das Gespenst unmittelbar drohender Hungersnot an die Wand; war auch das italienische Heer von einer schleichenden Krise befallen und wurde schließlich die russische Millionenarmee von den verzehrenden Hieben der ersten Revolution gerüttelt. Was wäre geschehen, wenn in diesen Zeit- [514] läuften das Vergeltungsschwert der Mittelmächte irgendwo in den Belagerungsring des feindlichen Bundes hineingefahren wäre: etwa auch durch eine Offensive gegen Italien, wie sie eben Conrad, ohne gehört worden zu sein, vorgeschlagen hatte? Es heißt keine allzu gewagte Frage stellen, wenn man Erwägungen darüber anstellt, ob die Mittelmächte damals nicht vielleicht die letzte Gelegenheit vorübergehen ließen, den Krieg noch zu ihren Gunsten zu entscheiden. In den Monaten nach Gorlice, vor dem ersten Rückschlag bei Luck, stand Conrad auf der Höhe seines Ruhmes. Sein Hauptquartier befand sich in dem alten deutsch-schlesischen Städtchen Teschen. Er hatte sein Büro im dortigen Gymnasium aufgeschlagen. Hier sah man ihn täglich an seinem hohen Stehpult arbeiten: klein, zierlich, in einer alten, zerschlissenen Soldatenbluse, die noch lange, nachdem ihr Träger zu dem Rang eines Generalobersten aufgestiegen war, die Abzeichen des früheren Dienstgrades aufwies; das Antlitz mit den wunderbar klugen Augen in ständiger nervöser Zuckung, die aber der Bedeutung des fesselnden Kopfes keinerlei Abbruch tat. Die Zimmereinrichtung zeugte für die Bedürfnislosigkeit ihres Bewohners. Auf großen Tischen lagen mächtige Karten ausgebreitet, die wegen der stets offen gehaltenen Fenster den größten Teil des Jahres mit Steinen beschwert werden mußten. In einer Ecke hatte der Flügeladjutant ein kleines Tischchen. Die Sitzgelegenheiten bestanden aus ein paar hölzernen Sesseln. Eine Tür führte unmittelbar auf den Gang hinaus, der gleichzeitig als Wartezimmer diente, eine zweite in das Zimmer, in welchem Conrads treuester Helfer, der Chef der Operationsabteilung, General Metzger, arbeitete. Von den Fenstern bot sich ein herrlicher Ausblick auf die Karpathen und in das Olsatal, das der Generalstabschef täglich mindestens zweimal eiligen Schrittes durchmaß. In dieser Umwelt spielte sich der Dienst im Herzen der Heeresleitung ab. Hier arbeitete er, hier wickelte er seine Korrespondenz ab, hier empfing er Besuche vom gekrönten Haupte bis zum jungen Leutnant herab, hier standen tagein, tagaus seine Mitarbeiter vor ihm, um ihm über die mannigfachen Bedürfnisse des Heeres Bericht zu erstatten, seine Weisungen entgegenzunehmen. Lange ermüdende Vorträge liebte Conrad bei seinen Referenten nicht. Er zog es vor, das Aktenmaterial selbst zu studieren. Jedes der unzähligen Schriftstücke, die durch seine Hand gingen, zeigt Unterstreichungen, kürzere oder längere rasch hingeworfene Randbemerkungen, sehr oft auch kleine schematische Skizzen, die den geübten Zeichner verrieten. Im Brennpunkte seines Wirkens im Kriege standen naturgemäß die Aufgaben der eigentlichen Kriegführung. Es gab keinen Feldzugsplan, der nicht sein ureigenstes Werk gewesen oder doch von ihm entscheidend beeinflußt worden wäre. In dieser Hinsicht erkannte er keinen sonst noch so geschätzten Berater an. Auch General Metzger, ein Mann von ausgezeichneten Gaben und lauterster Gesinnung, machte hierin keine Ausnahme. Conrads strategische Autorität war übrigens für seine Mitarbeiter so unbestritten, daß es keiner gewagt hätte, sich [515] ihm auf diesem Gebiete mit Ratschlägen aufzudrängen. Er wandelte wie die größten seiner geschichtlichen Vorgänger auf einsamen Höhen. Neben der engeren Kriegführung war es die äußere Politik, die dem Feldmarschall besonders am Herzen lag. Auch was in diesem Belange an Denkschriften und Aufzeichnungen vorliegt, stammte in der (oft vernichteten) Urschrift fast ausschließlich von seiner Hand. Conrad schrieb leicht und gerne; nur selten kam es vor, daß seine Umgebung an ein flüchtig hingeworfenes Konzept noch eine Feile anlegen zu müssen glaubte. Das flüssige Deutsch, das Conrad schrieb, sagte sich in seinen dienstlichen Entwürfen nicht ganz von der militärischen Amtssprache seiner Jugend los. In seinem privaten Schriftverkehr finden sich Sätze und Wendungen, die einem Goethe keine Unehre gemacht hätten. In der während des Weltkrieges sich vollziehenden Einkreisung der Mittelmächte sah er erbitterten Herzens eine Bestätigung für die Richtigkeit der von ihm vor dem Kriege vertretenen Auffassungen. Bald nach Gorlice regte er an, Rußland goldene Brücken für einen Frieden zu bauen, wobei seiner Ansicht nach die polnische Frage nicht hindernd wirken durfte; er hätte mitunter eine vierte Teilung Polens der vom Ballhausplatz angestrebten austropolnischen Lösung vorgezogen. In der Balkanfrage kehrte er zu den grundsätzlichen Gedanken der Zeit vor dem Kriege zurück. Nach der Niederwerfung Serbiens und Montenegros schien ihm der Augenblick gekommen zu sein, diese Länder der Monarchie einzuverleiben und damit eine günstige Lösung der südslawischen Frage im Sinne seiner Vorschläge aus der Friedenszeit vorzubereiten – Gedanken, mit denen er freilich auf die heftigste Gegnerschaft des ungarischen Ministerpräsidenten Tisza stieß. Dagegen vermochte er sich für die Wiedererrichtung eines selbständigen Albaniens nicht mehr auszusprechen, sondern nur mehr für eine Teilung dieses Landes zwischen Österreich-Ungarn, Bulgarien und Griechenland. Um einen Grad weniger stark, aber doch auch nachdrücklich genug, stellte Conrad die innere Politik unter seine Beobachtung, vor allem aus dem Blickfeld der im Heere auftauchenden nationalen Fragen. In seiner Staatsauffassung verleugnete Conrad – wie auch in manch anderem – nicht den altliberalen Geist seiner Jugendzeit. Die daher stammenden zentralistischen Neigungen wurden im Kriege eher stärker denn schwächer. Dennoch blieb er zugleich so weit Föderalist, daß er den slawischen Nationen des Reiches eine möglichst weitgehende kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung gesichert wissen wollte. Seine Stellung gegen die ungarischen Sonderbestrebungen verschärfte sich angesichts des Zuwachses an Geltung, den Ungarn dank seiner wirtschaftlichen Stärke und der überragenden Persönlichkeit Tiszas im Kriege gewann. Verschiedene Vorschläge des Generalstabschefs zur Stärkung der autoritären Staatsführung riefen zur Zeit, da sie gestellt wurden, mancherlei Kopfschütteln hervor. Eine spätere Epoche, die den Begriff des "totalen Krieges" aufstellte, wird ihnen weit größeres Verständnis entgegenbringen. [516] Der Feldmarschall verlangte, wie von der Truppe, so auch von seinen Mitarbeitern nicht wenig; aber die liebenswürdige, kameradschaftliche Art, mit der er seine Anforderungen stellte, eroberte ihm die Herzen. Er war gegen seine Umgebung stets gleich gütig, in den spärlichen Tagen des Glückes ebenso wie in den viel zahlreicheren des Mißgeschicks und der Verärgerung. Nur äußerst selten zeigte er sich wortkarg. Meist war er in trüben Stunden sogar mitteilsamer als in den guten – und er machte dann in dem Vertrauen, das er seinem jeweiligen Gegenüber erwies, nach Alter, Stellung und Dienstgrad sehr oft keinen Unterschied. Nur in Ausnahmefällen erwies er sich als guter Hasser, der dann allerdings schwer zu bekehren war. Jeglicher Pose, jeglichem Zeremoniell und Schaugepränge war Conrad von Hötzendorf aus tiefster Seele abgeneigt. Seinem Streben, sich möglichst im Hintergrunde zu halten, bot die Rücksicht auf den erzherzoglichen Oberbefehlshaber eine willkommene Begründung. Diese traf, soweit Frontreisen in Betracht kamen, sicherlich zu. Denn derselbe Conrad, den die Armee, als er noch Chef des Generalstabes war, nur ein paarmal flüchtig zu sehen bekam, weilte später, als Höchstkommandierender in Tirol, nirgends lieber als unter seinen Truppen. Im übrigen hat es ihm während seines Wirkens im Hauptquartier gewiß außerordentlich behagt, daß ihm der Erzherzog-Generalissimus die lästigen Repräsentationspflichten abnahm. Allerdings führte dies zu einer gewissen freiwilligen Abschließung, die der Gewinnung von richtigen Urteilen über Menschen und Dinge nicht immer zustatten kam. Auch gegenüber der Presse, die er im Grunde seines Herzens als lästige Einrichtung empfand, war Conrad im allgemeinen sehr zurückhaltend. Dennoch zeigte sich gerade auf dem heiklen Gebiete der öffentlichen Meinung, wie sehr er alles eher denn ein einfacher, leicht zu erfassender Charakter gewesen ist. Wenn überhaupt, so konnte man seinen Unwillen dann zu fühlen bekommen, wenn aus Wien, von privater Seite – der Marschall führte einen ziemlich ausgedehnten Briefwechsel – eine Klage darüber einlief, daß die Verdienste der österreichisch-ungarischen Truppen im eigenen oder im deutschen Heeresbericht zu wenig hervorträten. Sicherlich fühlte sich der Generalstabschef mit seiner heißgeliebten Armee so sehr eins, daß er unter deren wirklicher oder scheinbarer Zurücksetzung stets außerordentlich litt. Aber es gab gewiß auch Fälle, in denen sich hinter diesem Groll zugleich Kränkung über eine Zurücksetzung der eigenen Person barg und jener im Unterbewußtsein schlummernde persönliche Ehrgeiz, ohne den er kein guter Soldat gewesen wäre. Es waren Fälle, in denen er es als Mißgunst eines persönlichen Schicksals empfand, wenn sein weit jüngerer und an Begabung gewiß zurückstehender Kamerad, der deutsche Generalstabschef Falkenhayn, durch den Kriegsgott mehr begünstigt wurde als er selbst, und er mochte es dann wohl auch als seine besondere Tragik fühlen, daß es ihm nur zweimal, in [517] Montenegro und bei Vielgereuth-Lafraun, vergönnt war, Angriffssiege ohne Mitwirkung des stärkeren Bundesgenossen zu erringen. Nun ließ sich freilich – General von Cramon hat es in seinem ersten Buche fesselnd hervorgehoben – kaum ein größerer Gegensatz denken als der, der zwischen Conrad und Falkenhayn sowohl dem Äußern wie auch ihrer Veranlagung nach klaffte. Während sich der persönliche Verkehr zwischen Conrad und Moltke in den freundschaftlichsten Formen abgespielt hatte, fanden Conrad und Falkenhayn vom ersten Tage an nicht die für ein ersprießliches Zusammenarbeiten nötige innere Berührung, und mit zunehmender Kriegsdauer wurde der dienstliche Verkehr beiden Männern nachgerade zu einem körperlichen Schmerz. Zu Weihnachten 1915, in einer für die Fortführung des Krieges besonders wichtigen Zeit, kam es zum offenen Bruche, der für die bis zum Sturz Falkenhayns folgenden Monate nur mehr notdürftig verkleistert werden konnte. Bei diesen persönlichen Gegensätzen wurden auch die großen Kriegsprobleme sehr leicht aus der Sphäre des Sachlichen hinausgedrängt, was die Bündniskriegführung sicherlich nicht erleichterte. Die Stellung, die Conrad im Kriege zum Bündnis bezogen hatte, geht aus einem Briefe hervor, den er am 7. Februar 1918, während der Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk geschrieben hat: "Ich habe in diesem Kriege immer nicht nur den Kampf um die Existenz unserer Monarchie, sondern auch um die Existenz des Deutschtums gesehen und von diesem doppelten Standpunkte aus stets das enge Zusammengehen mit Deutschland nicht nur vertreten, sondern, solange ich in leitender Stellung stand, auch in die Tat umgesetzt; nur habe ich wohl erwartet, daß auch deutscherseits dieses Zusammengehen als Existenzbedingung gewürdigt und als gemeinsames Interesse Gleichberechtigter erachtet wird. Jedes einseitige Abweichen von dieser Linie hielte ich für verhängnisvoll: für unsere Monarchie, für das Deutschtum, aber auch für Deutschland..." Daß Conrad ein bequemer Bundesgenosse gewesen sei, läßt sich gewiß nicht behaupten. Zumal in dem Kampfe gegen die Bestrebungen der deutschen Heeresleitung, auf die gemeinsame Kriegführung beherrschenden Einfluß zu gewinnen, war er unermüdlich, wobei sich persönliche Verstimmung mit der wohl nicht abzuweisenden sachlichen Erwägung paarte, daß eine allzu weitgehende und sinnfällige Unterordnung des österreichisch-ungarischen Heeres unter das deutsche Kommando für den habsburgischen Nationalitätenstaat aus innenpolitischen Gründen schwer tragbar war. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und der deutschen Kriegführung drängten Conrad in vertraulichen mündlichen und schriftlichen Äußerungen zuzeiten manches harte Wort über den Bundesgenossen auf, das man, aus dem Zusammenhang gerissen, als den Beweis irgendeiner Deutschland grundsätzlich abgeneigten Einstellung betrachten könnte. Conrad hat eine solche Auslegung bis in die letzten Tage seines Erdendaseins entschieden zurückgewiesen und immer wieder betont, daß der Meinungsstreit zwischen ihm [518] und der deutschen Führung mit seinem unerschütterlichen Gefühl der Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum nie und nimmer etwas zu tun gehabt habe. Daß dem so war, hebt der schon dem Tod Geweihte im Vorwort des letzten Bandes seiner Denkwürdigkeiten ausdrücklich hervor und zeigte sich in dem Bekenntnis, das der Marschall, zugleich noch voll schwerster Verstimmung über den Abfall der früheren Staatsgenossen, unmittelbar nach dem Umsturze zum gemeindeutschen Schicksal ablegt: "Jedes Volk muß ein großes Ziel haben, dem es als Ideal entgegenstrebt... für jeden Deutschen kann seit dem Weltkriege dieses Ideal nur in dem endgültigen Zusammenschluß zu einem mächtigen Reich deutscher Zunge bestehen... Und so gibt es für uns nur mehr das eine Ziel, die Vereinigung mit unsern Stammesbrüdern." Und in tiefer Verbitterung läßt er diesem Bekenntnis den Satz folgen: "Welcher Deutsche könnte es über sich bringen, Verbindungen einzugehen, die uns nach den Erlebnissen des Weltkrieges in die Lage bringen könnten, gegen Deutsche zu kämpfen und wieder für die Interessen jener Hochverräter zu bluten, die unser altes großes Vaterland zerrissen haben." War der Kampf mit Falkenhayn der schwerste persönliche Meinungsstreit, den Conrad im Kriege auszufechten hatte, so ist doch zugleich zu sagen, daß dieser liebenswürdige Vorgesetzte und Mensch auch sonst alles eher denn ein bequemer Kollege oder Untergebener sein konnte. Das war schon in den Gegensätzen zu Aehrenthal und Schönaich wahrzunehmen und erwies sich namentlich auch gegenüber Tisza, wenngleich gerade in den Auseinandersetzungen zwischen diesem und Conrad ein Unterton von gegenseitiger Achtung vor der Persönlichkeit hindurchklang. Auch die Beziehungen der Heeresleitung Conrads zu anderen Männern und Ämtern der Staatsleitung ließen mitunter sehr zu wünschen übrig. Zu den grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten und dem Bestreben des Generalstabschefs, in wichtigen politischen Fragen gehört zu werden, kam bei diesem noch hinzu, daß er im Dienstverkehr die Wechselrede nicht liebte und das geschriebene dem gesprochenen Wort vorzog, unbekümmert darum, daß jenes, wenn es Kritik war, ungleich härter und nachhaltiger wirkte als dieses. Zu allem Überfluß wurde der vielfach berechtigte militärische Wissensdrang der Zentralstellen durch Conrad in der Regel nur sehr unvollständig gestillt. Das verstimmte namentlich die Vertreter des Außenministeriums, denen der Marschall schon wegen ihrer Zugehörigkeit zur Diplomatie wenig Zuneigung entgegenbrachte. Aber selbst der Kriegsminister wurde mit Nachrichten über den täglichen Kriegsverlauf nur spärlich bedacht, und noch ein Höherer, der greise Kaiser und König, nahm, zumal in der ersten Kriegszeit, wiederholt Anlaß, sich über die Verschwiegenheit der Heeresleitung zu beklagen. Daß Franz Joseph dem Feldmarschall gegenüber besonders tiefe persönliche Sympathien gehegt habe, wurde von seiner Umgebung in Abrede gestellt. Dazu sei der General schon zu sehr Schützling des Thronfolgers gewesen, mochte dieser auch zuletzt die Hand wiederholt von ihm abgezogen haben. Auch die kurz an- [519] gebundene und nicht selten ungeduldige Art Conrads beim Vortrage verstimmte den Kaiser, ohne daß er sich das allerdings – Ausnahmen kamen vor – gemeiniglich anmerken ließ. Zuzeiten ließ sich der nüchterne Herrscher mit leisem Vorwurf vernehmen, der Generalstabschef habe für einen Österreicher einen Fehler, er könne nicht mit Wasser kochen. Das Vertrauen in das Glück seines Feldherrn hatte bei dem pessimistischen Herrscher schon durch den Verlauf der ersten Schlachten einen merklichen Stoß erlitten, dessen Wirkung zu mindern die zahlreichen Gegner Conrads keinen Anlaß nahmen. Mehr als einmal schien der Sturz des Generalstabschefs unmittelbar bevorzustehen, und wenn er dann dennoch ausblieb, so war dies nicht zum geringsten dem treuen Festhalten des Erzherzogs Friedrich an seinem Stabschef zuzuschreiben. Conrad, dessen Selbstgefühl für einen richtigen Autoritätsglauben im allgemeinen nur wenig Raum ließ, war dem alten Kaiser trotzdem nicht nur in ritterlicher Vasallenschaft ergeben, sondern er ließ sich noch im letzten Lebensjahre des vielgeprüften Herrschers gegenüber einem seiner nächsten Berater vernehmen: "Der Kaiser ist doch noch der klügste von euch allen." Gegenüber dem Kaiser Karl war das Werden eines solchen Verhältnisses schon wegen des Altersunterschiedes unmöglich, und Conrad selbst kennzeichnete bei Gelegenheit die Lage in seiner bildhaften Art: "Eigentlich kann ichs begreifen, daß mich der Kaiser weggeschickt hat; auch eine junge Frau nimmt nie gerne die alte Erzieherin aus dem Elternhaus in den neuen Hausstand mit." Die Gründe für die Enthebung Conrads von der Leitung des Generalstabes, Februar 1917, waren mancherlei: Conrads selbstherrliche Art, die den jungen Herrscher verstimmte, der Gegensatz des Feldmarschalls zu Tisza, dessen Stellung allerdings auch schon wankend geworden war, Meinungsverschiedenheiten im Sachlichen, Persönlichen, nicht zuletzt auf dem Gebiete der Weltanschauung. Kaum zu seinem Nutzen ließ sich der Feldmarschall noch bewegen, den Oberbefehl an der Tiroler Front zu übernehmen. Wenn man von dem Abwehrsieg absieht, den seine Truppen im Sommer 1917 in den Sieben Gemeinden errangen, blieb ein sinnfälliger Erfolg seiner Kommandoführung aus. Wohl aber wurde er im Juli 1918 der öffentlichen Meinung als Opfer für die Niederlage dargebracht, die das Heer trotz allen Anstrengungen einige Wochen zuvor erlitten und die ihren Ausgang an seinem Frontteil genommen hatte.
Der Zusammenbruch Altösterreichs zerstörte auch Conrads Lebenswerk und das wunderbare, große, ehrwürdige Reich, dem er dieses Werk mit aller Hingabe gewidmet hatte. Der Marschall zog sich zunächst nach Innsbruck zurück, wo er bis zu seiner 1922 erfolgenden Rückkehr nach Wien verblieb und im obersten Stockwerk eines Hotels mit seiner Gattin zwei Kammern bewohnte. In dieser Umwelt entstanden, während auf einem elektrischen Kocher frugale Mahlzeiten zubereitet wurden, die ersten Bände seines großen Erinnerungswerkes Aus meiner Dienstzeit. Es wäre ein Irrtum, zu wähnen, daß ihm diese Arbeit durchwegs Freude bereitet hätte. "Wenn man wie ich", konnte man den verständnisvollen Kenner der Philosophen sagen hören, "so nahe dem Nirwana ist, dann hat man die Sehnsucht, den Zusammenhang mit der Erde wieder möglichst eng zu gestalten." Diesen Zusammenhang suchte und fand der Feldmarschall, so lange er in seinem geliebten Tirol weilte, auf weiten Bergwanderungen. Auch zu philosophischer, kunsthistorischer und allgemein geschichtlicher Lektüre griff er gern, nicht ohne daß er die Bücher, wenn sie ihm gehörten, mit immer originellen Randglossen versah. Mit Vorliebe wandte sich Conrad, der Französisch und Italienisch fließend, aber auch eine Reihe slawischer Sprachen ausreichend beherrschte und in seinen letzten Lebensjahren auch noch Englisch betrieb, fremdsprachigem Lesestoff zu. Bei dieser Vielfalt des Wissens und der Interessen, die in den Jahrzehnten vor dem Kriege durch weite Reisen noch gefördert worden war, störte ihn das Bücherschreiben unter Druck bei seiner ersehnten Einkehr in sich selbst. Auch das Bemühen anderer Memoirenschreiber, sich zu rechtfertigen, lag dem bei aller Schlichtheit seines Wesens stolzen und selbstbewußten Manne durchaus fern. Er war bei der Verfassung seiner Denkwürdigkeiten, deren geldlicher Ertrag übrigens auch seine kargen Lebensverhältnisse etwas bessern sollte, lediglich von dem Streben erfüllt, der Erforschung der geschichtlichen Wahrheit zu dienen. Tagesmeinungen, auch wenn er sie gegen sich herausforderte, waren ihm dabei gleichgültig. Dennoch war dieses Tun, wie flüchtig hingeworfene Tagebuchnotizen aus seinen letzten leidvollen Jahren deutlicher als seine Bücher bewiesen und auch seine ergreifenden Worte auf dem Sterbelager bezeugten, von einer ständigen Gewissenserforschung, von unablässiger seelischer Selbstprüfung begleitet, wobei ihn insbesondere – bewußt oder unbewußt im Zusammenhang mit seinem persönlichen Anteil am Weltgeschehen – zwei Fragen bewegten: die der Rolle des Krieges im Leben der Völker und die seiner erfolgreichen Führung gegenüber der Wucht von Masse und Material. Der Marschall war den größten Teil seines Lebens dem rationalistischen Denken der altliberalen Ära nahegestanden, deren Kindschaft er ja auch sonst nicht verleugnete. Die großen Probleme, die im [521] späten Alter auf seiner Seele lasteten, ließen ihn, der seit je zu Pessimismus und Resignation neigte, in die Lehren des Buddhismus und anderer östlicher Religionen flüchten. Wenn er in diesen Lehren von der Wehrlosigkeit des Einzelnen gegenüber einem vorbestimmten Schicksal und von der Bedeutungslosigkeit eines solchen Einzelschicksals im All las, dann fand er darin auch Trost gegenüber den großen Enttäuschungen seines Lebens. Ob der alte Soldat vor dem letzten Appell doch noch den Weg zu jenem Gott zurückfand, dessen Namen der Skeptiker nie ohne den Zweifel an seiner Existenz aussprach, wissen wir nicht. Größte Achtung vor der religiösen Überzeugung anderer, wenn sie Überzeugung war, hat er allezeit an den Tag gelegt. Knapp, nachdem der Feldmarschall den fünften Band seines unvollendet gebliebenen Memoirenwerkes vollendet hatte, nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand. Eine Lungenentzündung gewährte dem seit langem von einem schweren Gallenleiden Gequälten ein rasches Ende. Von Mergentheim bis an die Grenzen des Reiches gab dem Toten die Reichswehr, diese ruhmreiche Trägerin glorreichster deutscher Soldatentradition, das letzte Geleit. Seine Beisetzung in der Heimat war das erste Staatsbegräbnis, das Neuösterreich einem Manne des alten Regimes zuteil werden ließ. Hinter seinem Sarge schritt, zur Zeit nicht Regierungschef, aber doch einer der besten Söhne des Landes, Dr. Ignaz Seipel. Vertraute Kommandoworte ertönten, die Musik ließ das Lied vom guten Kameraden erklingen, Kanonendonner rollte über das offene Grab auf dem Friedhof, der sich in der Bannmeile des alten Kaiserschlosses Schönbrunn erstreckt. Zum erstenmal seit den grauen Tagen des Umsturzes besann sich vor diesem offenen Grabe das deutsche Österreich wieder auf sich selbst. Und als man den Feldmarschall dann einige Jahre später in eine von Kameradentreue gewidmete Gruft überführte, da lag über seinem Sarg die schwere, goldgestickte Decke, die zwei Jahrhunderte früher den Prinzen Eugen von Savoyen auf seinem letzten Weg umhüllt hatte. Eine Kette großer Überlieferungen war bildhaft geschlossen.
 |