
 Bd. 4: Der Seekrieg - Der Krieg um die
Kolonien
Bd. 4: Der Seekrieg - Der Krieg um die
Kolonien
Die Kampfhandlungen in der Türkei
Der Gaskrieg - Der Luftkrieg
Abschnitt: Der Krieg um die
Kolonien (Forts.)
Oberst Dr. Ernst Nigmann

5.
Deutsch-Südwestafrika.
Die 1884 erworbene
Kolonie Südwestafrika hatte etwa die anderthalbfache
Größe des Deutschen Reichs. Im Süden und Osten war
England (Kapkolonie) ihr Nachbar, dem auch die der Küste vorgelagerten
Guano-Inseln und die Walfischbay gehörten, während sie
nördlich an portugiesisches
Gebiet - Angola - grenzte. Südwestafrika ist eine anfangs
sanft, dann steiler ansteigende Terrassenlandschaft, die sich binnenwärts
noch innerhalb der Ostgrenze wieder zu senken beginnt. Der
Küstengürtel, die Namib, ist öde, nur die Täler der
größeren Flüsse bilden Oasen. Das Innere, die Mitte der
Kolonie, ist von zahlreichen Gebirgsketten durchzogen, die dann wieder nach
Osten zu der Kalahari-Steppe abfallen. Von den wenigen Flüssen
führen nur Oranje und Kunene dauernd Wasser, die übrigen liegen
während des größten Teils des Jahres trocken. Die Frage der
Wassererschließung war daher im Frieden, mehr noch während der
Kriegführung, auf beiden Seiten eine der wichtigsten. Die weiße
Bevölkerung der Kolonie bestand aus etwa 15 000 Köpfen,
davon waren:
2000 Mann Friedensstärke der Schutztruppe,
6000 Frauen und Kinder,
5000 erwachsene deutsche Männer der
Zivilbevölkerung und
2000, meist feindliche, Ausländer.
Aus diesem Mißverhältnis zwischen Deutschen und
Ausländern geht schon eine grundlegende Schwierigkeit hervor: eine
einheitliche Erhebung, ein restloses Zusammenarbeiten aller Weißen, wie es
in so unvergleichlicher Weise die Kolonie
Deutsch-Ostafrika vollbracht hat, war hier nicht möglich.
Deutschfeindliche Strömungen und Stimmungen, ja Spionage und Verrat,
mußten bei diesem gewaltigen Prozentsatz von feindlichen
Ausländern an der Tagesordnung sein. Dieser Umstand darf bei Beurteilung
der südwestafrikanischen Kämpfe nicht außer acht gelassen
werden. Die Mehrzahl der Weißen waren Siedler, mit diesen mußte
die geringe Truppe aufgefüllt werden. Man darf sich aber nun durchaus
nicht vorstellen, daß die zur Vervollständigung der Truppe
eingezogenen Deutschen der Zivilbevölkerung etwa kraftstrotzende
Reitersleute gewesen wären, deren Büchse niemals fehlte; oft war
eher das Gegenteil der Fall. Die schwere Arbeit des Siedlers strengt, namentlich
bei der sehr unregelmäßigen, auch inhaltlich oft mangelhaften
Ernährung, außerordentlich an; der Mensch dörrt aus, altert
schnell, verliert an Körperkraft und auch an Energie. So war namentlich, als
man zuletzt eben auf alles, auch das letzte Menschenmaterial zurückgreifen
mußte, die Truppe [363] nur von sehr
beschränkter Gefechtskraft. Eine wohldisziplinierte Eingeborenentruppe
wäre, wie in anderen Kolonien, so auch hier wohl zu längerem
Widerstand befähigt gewesen.
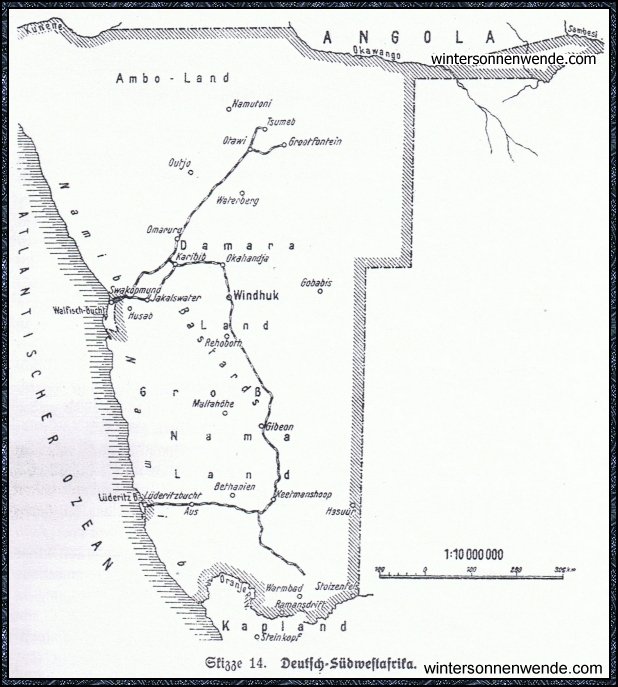
[363]
Skizze 14: Deutsch-Südwestafrika.
|
Die Eingeborenenbevölkerung bestand im wesentlichen aus etwa
60 000 Hereros, Damara und Buschleuten. Die in der Gegend von
Rehoboth ansässigen Bastards, etwa 3000 Köpfe, eine Mischung von
Eingeborenen und Buren, bildeten eine "Nation" für sich und standen in
jeder Beziehung höher als die Eingeborenen; von ihnen wird später
noch eingehender die Rede sein. Aufstände der [364] Hereros und
Hottentotten, zuletzt der große Aufstand 1904, hatten viel Werte an
Menschenleben, Kapital und Vieh vernichtet. Es war nur zu natürlich,
daß die Eingeborenen mit ihrem Mißgeschick nicht zufrieden,
daß auch die ihnen geschlagenen Wunden noch nicht verheilt waren.
Deshalb konnte man bei Beginn des Weltkrieges in Südwest der Haltung
der Eingeborenen den Deutschen gegenüber weniger sicher sein wie
anderen Orts, weshalb auf die örtliche Sicherung gegen die Eingeborenen
auch während der großen militärischen Handlungen niemals
verzichtet werden durfte. Immerhin war die deutsche Verwaltung zu Beginn des
Weltkrieges auf gutem Wege, die Eingeborenen zu brauchbaren Mitarbeitern
heranzuziehen, und tatsächlich haben sich die Eingeborenen gut gehalten.
Mit Ausnahme der vom englischen Einfluß besonders bearbeiteten Bastards
sind sie ruhig geblieben; davon, daß sie die Engländer herbeigesehnt
hätten, um sie vom deutschen Joche zu befreien, kann gar keine Rede sein.
Ebenso wie in
Deutsch-Ostafrika, Kamerun und der Südsee denkt der
Eingeborene über die Segnungen der britischen Herrschaft im Gegensatz
zur deutschen recht zweifelnd.
Es steht heute unbedingt fest, daß es seit langem britische Absicht war,
Südwest dem britischen Empire einzuverleiben. Englische Politik hat es
seit Jahrhunderten verstanden, Kolonien durch Mühe und Kosten anderer
aus dem Rohen herausarbeiten zu lassen, um sich dann selbst in die
wohlaufgebaute Kolonie zu setzen. Dieses, Franzosen, Holländern und
Spaniern gegenüber angewendete Verfahren griff erst recht hier Platz, wo
die deutsche Kolonie als Keil inmitten Britisch-Südafrikas (das
nördlich angrenzende, von England völlig abhängige
portugiesische Gebiet rechnet nicht) gelegen war. Und die Diamantfunde 1908
waren sicher geeignet, die britische Begehrlichkeit nicht
abzuschwächen.
Eine Vorbereitung zum Kampf gegen einen äußeren Feind war in
Südwest ebensowenig planmäßig vorgesehen wie in den
anderen Kolonien; für eine solche wäre die Volksvertretung in der
Heimat auch niemals zu haben gewesen. So konnte von einem angriffsweisen
Vorgehen gegen den britischen Nachbar keine Rede sein, das
Kräfteverhältnis dafür machte ein solches von vornherein
aussichtslos. Es handelte sich also um Verteidigung, um möglichst lange
hinhaltende Kriegsführung unter Binden der feindlichen Kräfte.
Hoffte man doch, und mit voller Berechtigung, daß die für
Deutschland günstige Entscheidung in nicht zu ferner Zeit in Europa fallen
würde.
Der Schwerpunkt des deutschen Grenzschutzes lag an der
Süd- und Südostgrenze; dem im Verhältnis zum deutschen
Gebiet reichen britischen Südafrika war es nicht schwer, mit seinen vielen
Mitteln und unter Anschluß an sein Eisenbahnnetz, das öde
Grenzgebiet zu überwinden. Ferner war mit Truppenlandung in
Lüderitzbucht und in der Walfischbai zu rechnen. Zur Abwehr waren
jedoch keine hinreichenden Kräfte deutscherseits mehr verfügbar, es
erschien daher besser, auf die Küstenverteidigung zu verzichten, den
Gegner sich mit dem breiten, der Küste folgenden
Wüstengürtel abfinden zu lassen und ihm an selbst gewählter
Stelle [365] später
entgegenzutreten. - Im Osten bildete die Kalahari ein starkes
natürliches Hindernis; hier war die Gefahr eines Einfalls
gering. - Die Verhältnisse im Norden, ebenso wie Portugals Haltung,
waren ganz ungeklärt. Starke Beobachtung war hier am Platze.
Die Truppe bestand aus 2000 Mann Friedensstärke; 5000
erwachsene Männer der deutschen Zivilbevölkerung waren
vorhanden. Wenn also - vorübergehend - die
Gesamtstärke von annähernd 6000 Soldaten erreicht wurde, so
erhellt daraus, daß tatsächlich alles eingestellt wurde, was noch
irgend brauchbar und abkömmlich erschien. So verblieben aber trotz
ständig notwendig werdender Entlassungen stets noch viele, namentlich
Tropen-, Herz- und Fieberleidende in der Truppe, die von sehr
fragwürdigem Gefechtswert waren. - Die Ausbildung der Truppe
selbst war gut. Nachteilig war allerdings, daß die Kompagnien, Batterien, ja
Züge räumlich weit voneinander getrennt waren, so daß die
höheren Vorgesetzten manche Teile der Truppe selten zu sehen bekamen,
daß auch Übungen in größeren und gemischten
Verbänden kaum stattgefunden hatten. Die Truppe war, wie bekannt, eine
berittene Infanterie, dazu Feldartillerie mit Gebirgsgeschützen. Die
für die verstärkte Truppe nötigen Pferde ließen sich,
allerdings mit großer Mühe, aufbringen, Ersatz für
Abgänge war aber nahezu ausgeschlossen. Die Bewaffnung war
gut: Infanterie mit Gewehr 98, Artillerie mit dem Gebirgsgeschütz
Ehrhardt, Munitionsvorrat war reichlich vorhanden. Das Signalgerät
bewährte sich, mehr noch die fahrbaren Funkenstationen, die, wohl infolge
der reinen afrikanischen Luft, auf Entfernungen weit über 300 km
wirkten und viele wichtige Funksprüche der Schiffe auf See
abzuhören vermochten.
Das Bahnnetz war noch kurz vor dem Kriege durch Fertigstellung der
Nord-südbahn Windhuk - Keetmanshoop beendigt worden.
Dies war von ausschlaggebender Bedeutung, da nur auf diese Weise der Verkehr
zwischen der Hauptbasis Windhuk und dem ersten Hauptkriegsschauplatz an der
südlichen Grenze ermöglicht werden konnte. Kraftfahrzeuge
gelangten nicht zur Verwendung; zwei vorhandene veraltete Flugzeuge haben
Anerkennenswertes geleistet.
Die Verpflegung konnte dadurch, daß seitens der Regierung alles
Vorhandene großzügig erfaßt und auf Zivilbevölkerung,
Eingeborene und Truppe verteilt wurde, wenn auch knapp, im Gange gehalten
werden. Der Sanitätsdienst war, wie allerorts bei deutschen Truppenteilen,
auch hier auf der Höhe. - Die Wassererschließung war
für die Entwicklung der Kolonie ein Faktor von nahezu entscheidender
Bedeutung; eine großzügige, allerdings kostspielige Organisation
hätte dieses auch sicher erreicht. Bisher waren jedoch die vorhandenen
Wasserstellen nur spärlich. Auch diese wurden, um dem Gegner das
Vordringen zu erschweren, bis auf wenige, für Streifpatrouillen
notwendige, unbrauchbar gemacht. Eine wesentliche Erschwerung seiner
Kriegführung ist jedoch dem Gegner, der bestes Bohrgerät
überreichlich mitführte, hierdurch nicht entstanden.
[366] Unter dem
Kommandeur der Schutztruppe, Oberstleutnant v. Heydebreck, wurden anfangs
August an Feldtruppen aufgestellt:
| 3 |
Feldbataillone zu je 3 bis 4 Kompagnien (v. Rappard, Franke, Ritter) und
eine selbständige
(Kamelreiter-) Kompagnie, |
| 6 |
Batterien (reitende, Gebirgs- und 1 Haubitzbatterie), davon 3 in einer
Abteilung (Bauszus) zusammengefaßt, |
| 2 |
Verkehrszüge, |
| 2 |
Kolonnenabteilungen, |
| 4 |
Feldlazarette. |
An Besatzungstruppen: die verschiedenen Ortsbesatzungen und der
Küstenschütz Swakopmund.
Schließlich die unter den Etappenkommandos Nord, Mitte, Süd erst
allmählich entstehenden Etappentruppen.
Vorausgreifend seien hier noch einige Worte über das
"südafrikanische Freikorps" eingeschaltet, das allerdings erst etwas
später, Anfang September, entstand. Es mußte der Regierung daran
gelegen sein, die über das ganze Land zerstreuten nicht absolut
zuverlässigen Buren - die ja nicht wehrpflichtig
waren - in regierungsgenehme Bahnen zu lenken. Der Burenführer
Andries de Wet fand den richtigen Weg, indem er durch Aufruf zum Kampf
für die alte Burenfreiheit gegen die aufgedrungene britische Herrschaft
aufrief. So kam ein kleines, innerlich zwar wenig gefestigtes Korps zusammen,
das aber - der Bur ist eben Natursoldat! - doch recht Brauchbares
geleistet hat.
Beim Gegner waren nach dem Burenkriege an
national-britischen Truppen etwa gegen 10 000 Mann aller Waffen in
Südafrika verblieben. Die Organisation der Unionstruppen war: die
"permanent force": 5 Regimenter berittener Schützen mit
Sonderwaffen, und Reserven verschiedenster Klassen, die an den Orten ihrer
Kampfformationen alljährliche Übungen zu machen hatten. Bei einer
Zahl von ¾ Millionen auserlesener Männer bedurfte es daher
für den Führer der Unionstruppen Louis Botha keiner besonderen
Anstrengung, selbst nachdem die national-britischen Truppen nach Europa hatten
verbracht werden müssen, ein Heer von 60 000 Mann mobil zu
machen. Reit- und Zugtiere, Bewaffnung, Ausrüstung waren
mustergültig; Lastautos, Flugzeuge, Panzerkraftwagen, Panzerzüge
waren reichlich vorhanden. Der Generalissimus Louis Botha selbst war sicher ein
vortrefflicher Führer, der es leicht hatte, da ihm
überwältigende Kriegsmittel zu Gebote
standen; - war doch allein das Truppenverhältnis 12 : 1!
Vor allem hatte er eines für sich, was der kleinen deutschen auf
Verteidigung beschränkten Truppe fehlte: volle Bewegungsfreiheit.
Während der Mobilmachung war die dringlichste Sorge gewesen:
Aufrechterhaltung der Ruhe in der Kolonie und Bereitstellung des Grenzschutzes
gegen die südafrikanische Union. Hier war der gefährdetste Teil die
Südostecke, der gegen- [367] über eine ganze
Kette englischer Polizeistationen lag, die jeden Tag vorgetrieben werden konnten.
Diese Grenze zu sichern wurde das I. Feldbataillon (v. Rappard)
entsandt mit dem gleichzeitigen Auftrag, einen etwaigen feindlichen Vormarsch
über den Oranje aufzuhalten. - Das Etappenkommando Mitte mit
dem Standort Windhuk bildete den Mittelpunkt des Versorgungswesens,
während das Etappenkommando Nord von der gleichen Hauptbasis aus den
Teil bis zur portugiesischen Grenze umfaßte. Das Etappenkommando
Süd wurde bald, entsprechend den dort einsetzenden größeren
Operationen, geteilt und mußte zunächst vergrößert
werden, während es später, beim Zurückgehen der Truppe,
aufgelöst wurde.
Die Unionsregierung trat amtlich nicht sofort in den Krieg; sie griff aber gern
zwei kleine Vorfälle an der Südgrenze: unbeabsichtigte
Grenzüberschreitungen einer deutschen Beobachtungspatrouille und einen
ähnlichen Vorgang bei Verfolgung von Viehdieben, auf, um damit zum
Kriege zu treiben. Daß dies für die Union nur Vorwände
waren, geht einwandfrei aus der Drahtung Louis Bothas vom 4. August an die
britische Regierung hervor, in der er anbietet, "er wolle für die
Angelegenheiten der Union selbst sorgen, so daß die dort stehenden
national-britischen Truppen anderweitig verwendet werden könnten",
worauf die britische Regierung unter dem 7. August antwortete, "daß die
Besetzung der wichtigen Punkte von Südwestafrika als ein großer
dem Empire erwiesener Dienst empfunden würde". Hiernach stehen die
Absichten Englands und der Union auf Südwestafrika durchaus fest, wenn
auch letztere nicht sofort zur vollen Machtentfaltung schreiten konnte. Dort
machte sich nämlich die Unzufriedenheit mit Bothas Absichten bei einem
großen Teil der Bevölkerung durch offenen Aufstand Luft. Das durfte
die deutsche Regierung sich nicht entgehen lassen; sie trat daher mit dem
Kommandeur der Unionstruppen in Upington, dem Oberstleutnant Maritz, in
Verbindung, der als Führer der Bewegung zum Wiedergewinn der alten
Burenfreiheit galt. Im Oktober kam mit dieser Burenpartei ein Vertrag zustande,
demgemäß deutscherseits "die Aufständischen als
kriegführende Macht anerkannt, als Verbündete betrachtet und
behandelt werden sollten". Aber in der Leitung der Aufstandsbewegung im
ganzen wie in jeder Einzelbewegung zeigten sich die alten
Burenschwächen, ihre Uneinigkeit und persönliche Interessenpolitik;
jeder Kommandant führte seinen eigenen Krieg. So fiel es der
Unionsregierung nicht schwer, den Aufstand bereits bis Anfang Dezember 1914
niederzuschlagen.
Am 15. September erschien ein englischer Hilfskreuzer vor Swakopmund und
beschoß die offene Stadt. Damit wurden handgreiflich die Feindseligkeiten
eröffnet. So wurde denn jetzt auch kommandoseitig die
Grenzüberschreitung im Süden freigegeben und alsbald mehrere
englische Polizeistationen aufgehoben. Swakopmund, das inzwischen erneut
beschossen war, wurde geräumt, ebenso Lüderitzbucht, das sofort
vom Feinde besetzt wurde. Die noch zurückgebliebene
Zivilbevölkerung, meist Frauen und Kinder, wurde später im
Triumph als "German prisoners of war" durch Kapstadt
geführt!
[368] Mittlerweile setzten
sich feindliche Truppen in Sandfontein (südlich Warmbad) fest. Alles
ließ darauf schließen, daß dieser Platz, der sehr günstige
Wege und Wasserverhältnisse hatte, als erster Stützpunkt auf
deutschem Gebiet dienen sollte. Der Kommandeur entschloß sich daher ihn
anzugreifen. Die hierzu zusammengezogene Truppenmacht bestand aus vier, je 2
bis 3 Kompagnien starken Bataillonen (die sich aber zwecks Irreführung
des Gegners stolz Regimenter nannten!) mit insgesamt 3 Batterien. Nach
anstrengendem Marsche waren am 26. September früh die Truppen
zusammengezogen, so daß die Einschließung des Gegners vollendet
war. Von allen Seiten arbeiteten sich, nachdem die Batterien vorgearbeitet hatten,
die Regimenter durch die Klippen heran, Entsatzversuche des Feindes, die
über den Oranje zu Hilfe kommen wollten, wurden abgewiesen, und schon
gegen 5 Uhr Nm. ging beim Gegner die weiße Flagge hoch.
Wertvolles Kriegsgerät und gegen 300 Gefangene waren die Beute,
während die deutschen Verluste (2 Offiziere, 12 Reiter) gering waren.
Am gleichen Tage mit dem Gefecht von Sandfontein wurde an der Ostgrenze die
deutsche Polizeistation Hasuur von dem gegenüberliegenden englischen
Riedfontein aus überfallen, der Gegner aber blutig heimgeschickt.
In Lüderitzbucht hatte sich während dieser Ereignisse der Gegner
festgesetzt und gegen Land zu stark befestigt. Mitte Oktober nahm er bereits die
Wiederherstellung der deutscherseits abgebauten Bahn ins Innere auf.

Während der Schwerpunkt des Interesses bisher auf dem Süden des
Schutzgebietes lag, kam plötzlich eine Nachricht von Norden her, die
geeignet war, eine gänzlich veränderte Lage zu schaffen. Ende
Oktober wurde gemeldet, daß der Bezirksamtmann von Outjo,
Dr. Schulze-Jena, und seine beiden Begleiter beim Besuch des portugiesischen Forts
Naulila von der dortigen Besatzung ermordet worden seien. Bei der unsicheren
Haltung des nördlichen Nachbars, der Portugiesen, lag die
Befürchtung nahe, diese Tat sei der Auftakt zu offenen Feindseligkeiten.
Wie der Zusammenhang im einzelnen gewesen, ist nicht völlig
geklärt; so viel steht jedoch fest, daß einzelnen Deutschen
portugiesischerseits Grenzverletzung vorgeworfen wurde (die Grenze ist dort
noch nicht im Gelände festgelegt), daß bei den bezüglichen
Besprechungen der portugiesische Fortkommandant im deutschen Lager
Gastfreundschaft genossen und die Deutschen gebeten hatte, nun auch ihrerseits
seine Gastfreundschaft im portugiesischen Fort anzunehmen. Die Deutschen taten
dies, und sind dann, als sie anscheinend nach einem Wortwechsel mit dem
Kommandanten fortritten, von rückwärts her erschossen worden. Im
Einvernehmen mit dem Truppenkommandeur entschloß sich der
Gouverneur zu einer Expedition, die dem Major Franke mit 2 Kompagnien und
1½ Batterien übertragen wurde; rasches Zufassen sollte die geringe
Expeditionsstärke ausgleichen.
Das Ziel war Fort Naulila. Allerdings ging wegen Wassermangels der Vormarsch
nicht so schnell vonstatten, wie erwünscht, und erst Mitte Dezember
erreichte [369] die Expedition den
Grenzfluß Kunene. Fort Naulila war inzwischen durch Truppen aller
Waffen besetzt worden. Der portugiesische Kommandant, Oberst Roçadas, hatte
das Umgelände des Forts stark zur Verteidigung ausgebaut. Nach
mehrstündiger Artillerievorbereitung, wobei das Munitionsdepot des Forts
in die Luft ging, folgte energischer Infanterieangriff in 2 Kolonnen. Dem Kampf
Mann gegen Mann hielt der Gegner nicht stand, sondern trat nach Norden den
Rückzug an, der bald in wilde Flucht ausartete. Trotz seiner vielfachen
zahlenmäßigen Überlegenheit ließ der Gegner allein
gegen 200 Tote und Verwundete in den Stellungen
zurück. - Die Expedition hatte den großen nachhaltigen Erfolg,
daß nicht bloß die Gefahr auf dieser Front behoben, sondern
daß auch von Truppenansammlungen und Einfallsabsichten Portugals nicht
mehr die Rede war.
Einen schweren Verlust erlitt die Truppe in diesen Tagen: ihr ausgezeichneter
Führer, Oberstleutnant v. Heydebreck, verunglückte bei einem
Versuchsschießen mit Gewehrgranaten tödlich; sein Nachfolger
wurde der schon aus früheren Kämpfen rühmlich bekannte
Major Franke.
Wie schon hervorgehoben, hatte sich die Regierung der Kolonie mit den
Führern der aufständischen Burenbewegung in Südafrika,
insbesondere mit General Maritz in Verbindung gesetzt, dessen
Heeresgefolgschaft allerdings sehr bald auf nur 500 Mann zusammengeschrumpft
war. Die Verhandlungen waren endlos, die Burenparole "viel reden und wenig
handeln" wurde aufs gewissenhafteste befolgt, und es fiel schwer, bei der ganz
anderen Auffassung von Kriegführung und Mannszucht überhaupt
ein Zusammenwirken zu erzielen. Jedenfalls waren sie eine große
Geduldsprobe. Außer einem ziemlich planlosen, unentschieden gebliebenen
Gefecht bei Keimoes und mancherlei anderem Hin und Her erzielte Maritz mit
seiner Kriegführung im Unionsgebiet nichts und ging, nachdem er durch
viele Entsendungen - die er niemals wiedersah - einen erheblichen
Teil seiner Macht eingebüßt hatte, nach Stolzenfels auf deutsches
Gebiet zurück, wo er in wenig gefechtsfähigem Zustande
anlangte. - Das Freikorps (vgl. S. 366) war dem
Burenführer Kemp, der mit 600 Gewehren im Anmarsch gemeldet war, zur
Aufnahme entgegengesandt worden. Da die Burenführer nunmehr
energisches Vorgehen versprochen hatten, wurde auch eine bei Nous
(südlich Stolzenfels) gemeldete britische Abteilung überfallen, nach
Burenart unterblieb aber nicht bloß jede Verfolgung, die erfolgreichen
Truppen kehrten vielmehr seelenruhig in ihre Ausgangsstellungen in Gegend von
Ukamas zurück!
Auf dem südwestlichen Kriegsschauplatz war der Gegner von
Lüderitzbucht her an der Bahn, teilweise unter Benützung von
Panzerzügen - in die er Lazarettwagen mit weithin sichtbarem Roten
Kreuz eingestellt hatte - planmäßig nach Osten
vorgerückt. Einer von dem britischen Führer, General Mackenzie,
selbstgeleiteten gewaltsamen Erkundung traten die deutschen Kräfte bei
Haltestelle Garub entgegen. Der Gegner entwickelte sich gegen die Vorposten,
brach jedoch, als Verstärkungen aus den Pässen von Aus
heraustraten, das Gefecht ab, und ging zurück.
[370] Am ersten
Weihnachtsfeiertage 1914 erschien vor Walfischbay eine Anzahl
Transportdampfer und Leichter, und die Ausladung britischer Truppen begann.
Das war der Wendepunkt im Feldzuge; hiermit wurde die Eroberung des
Nordgebiets der Kolonie eingeleitet, und mit diesem mußte die ganze
Kolonie fallen. Ohne die Hilfsquellen des reicheren Nordgebiets war das
Südgebiet allein hilflos, und fiel von selbst. Es ist nicht ohne weiteres
verständlich, warum der feindliche Führer Louis Botha nicht schon
längst, von Walfischbay als Basis ausgehend, die Eroberung des Nordens
unmittelbar versucht hatte. Maßgebend hierfür kann vielleicht die
durch den Burenaufstand geschaffene Unsicherheit der innerpolitischen Lage
gewesen sein, vielleicht auch die unvollkommen durchgeführte Ausbildung
der "defence force", die ein sofortiges Ausrücken und eine
Übersee-Unternehmung nicht als ratsam erscheinen ließ. Aber auch
deutscherseits ist man sich anscheinend über die von Walfischbay her
drohende Hauptgefahr nicht im vollen Umfange klar gewesen; sonst hätte
man gewiß, selbst auf die Gefahr hin, die Truppen im Süden zu
schwächen, ein gefechtskräftigeres Detachement an diesen Teil der
Küste herangeschoben. Ob man nicht zu dieser Zeit überhaupt besser
getan hätte, den unproduktiven Süden des Schutzgebietes ganz
aufzugeben, und dafür mit allen Kräften den Feind in die See zu
werfen, ist eine weitere Frage. Daß solches erfolgbringend sein kann, zeigt
das Beispiel der Schlacht von Tanga in Deutschostafrika. (S. 393.)
Zwingend ergab sich aber jetzt die Notwendigkeit, durch offensive
Tätigkeit den Gegner zu binden. Hierfür war das
Nächstliegende ein Vorstoß ins Unionsgebiet, in Richtung auf
Upington. Da waren die Burenkommandos die gegebene Truppe; aber diese,
obwohl allein keinesfalls kampfkräftig genug, lehnten trotzdem die
Mitwirkung deutscher Truppen rundweg ab; ein Verhalten, das um so mehr zu
denken gab, als unmittelbar vorher schon unter besonderen
Schutzmaßregeln eine Unterredung der Burenführer mit englischen
Offizieren stattgefunden hatte. Doch gelangen den Burenführern, allerdings
wiederum nach vielem Hin und Her, durch Überraschung einige kleine
Erfolge gegen Unionstruppen. Auch der Angriff auf den feindlichen
Stützpunkt Upington wurde zwar angesetzt, aber nicht durchgeführt;
das Gefecht wurde abgebrochen und der Rückzug befohlen. Diese halbe
Aktion gegen Upington war der Anfang des Niederbruchs; es setzten
Verhandlungen ein und am 30. Januar streckten die Buren die Waffen, Maritz
flüchtete auf deutsches Gebiet. Das Freikorps, das nach dem
Zusammenbruch der Burensache nicht mehr recht zuverlässig erschien,
wurde nunmehr aufgelöst.
Auch deutsche Truppen, Major Ritter mit 3 Kompagnien und 1 Batterie, sollten,
über den Grenzfluß Oranje gehend, vorstoßen. Vorgeschobene
feindliche Kräfte, bei Kakamas (Sammelbegriff für eine Anzahl
weitverstreuter Kleinsiedlungen beiderseits des Flusses) gemeldet, wurden
angegriffen. Der Kampf verlief ungünstig: starke feindliche
Hilfskräfte rückten aus Upington
heran - die dort fechtenden Burenkommandos hatten ja (was die deutsche
Truppe nicht wußte)
in- [371] zwischen die Waffen
gestreckt -, so mußte auch hier das Gefecht abgebrochen und der
Rückzug angetreten werden.
Der in Walfischbay gelandete Gegner war inzwischen der Bahn folgend nach
Osten vorgegangen und hatte Husab erreicht. Gegen weiteres Vorstoßen
sollte die hierfür bestimmte Abteilung des Majors Wehle die Bergstellung
westlich der Linie Jakalswater-Riet halten. Daß hier der Hauptstoß zu
erwarten sei, war daraus ersichtlich, daß der Feind hier seine
Stützpunkte, Verpflegungs- und Wasserstellen gründlich ausbaute
und daß der Oberkommandierende Botha mit seinem Stabe anwesend war.
Zur Verteidigung der ausgedehnten Stellung standen insgesamt 4 Kompagnien
und 2 Batterien zur Verfügung. Die
Pforte-Husab-Berge steigen steil aus der Umgebung heraus, feindwärts ist
weite ebene Fläche, die scharfen Einschnitte in die steil aufsteigenden
Berge sind die "Pforten". Auch der Südhang und das
Swakop-Bett bilden ein Gewirr von Felsen und Schluchten. Die Ausdehnung der
Stellung war im Verhältnis zur Besetzung eine außerordentlich breite.
Allerdings war, eben infolge dieser großen Ausdehnung, die Gefahr,
umgangen zu werden, gering.
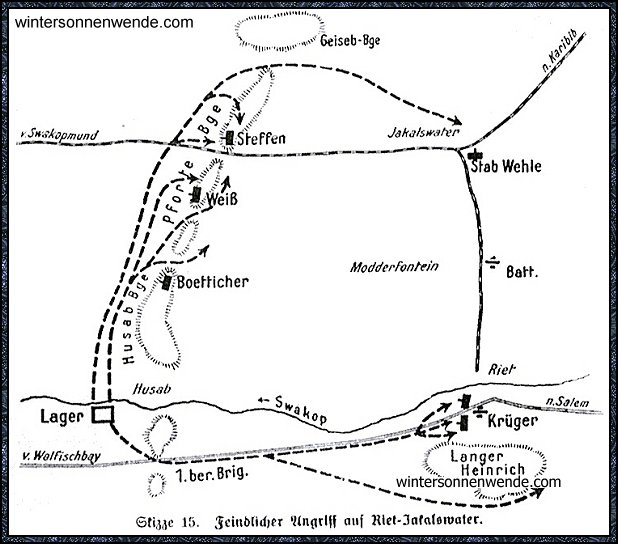
[371]
Skizze 15: Feindlicher Angriff auf Riet-Jakalswater.
|
[372] Der Gegner entfaltete
jeder der 3 Pforten gegenüber geschickt eine kampfkräftige Truppe,
so daß am frühen Morgen bereits die gesamte deutsche Front
gebunden war. Je etwa eine feindliche Kavalleriebrigade ging nun umfassend
gegen den nördlichen (rechten) und südlichen (linken) Flügel
der ausgedehnten Stellung vor. Bei Jakalswater wurde der Feind zunächst
abgewiesen, dagegen wurden die Abteilungen an den 3 Pforten ringsum
eingeschlossen (siehe Skizze) [Scriptorium merkt an: oben] und mußten nach
heldenmütigem
Widerstand und Verlust ihrer ganzen, ohnehin geringen Artillerie, die Waffen
strecken. - Der südliche, unter Hauptmann Krüger stehende
Flügel konnte ebenfalls sich der erheblichen feindlichen Übermacht
gegenüber behaupten und seine Stellung halten. Aber auch er mußte
zurückgehen, als bei ihm mittags der Befehl Wehles eintraf:
"Pfortestellungen vom Gegner genommen, Angriff auf Jakalswater
zurückgeschlagen, muß jedoch Jakalswater räumen. Da Ihre
rechte Flanke nunmehr ohne Schutz, befehle Rückzug, fechtend Swakop
aufwärts bis Rubas." - Immerhin fochten hier die deutschen
Kräfte, insgesamt gegen 500 Mann zählend, tapfer gegen 2 feindliche
Reiterbrigaden von je 2500 Mann, also 1 : 10.
Nach dem Gefecht von Garub (S. 369) hatten
die Unionstruppen diese Wasserstelle in Besitz genommen und sie zu reichlicher
Wasserversorgung schnell und geradezu vorbildlich ausgebaut. Für das
weitere Vorgehen des Feindes ließen sich jetzt drei feindliche
Vormarschrichtungen deutlich erkennen (siehe
Skizze auf S. 373):
Von Steinkopf über Ramansdrift,
von Nous über Stolzenfels,
von Upington über Nakab.
Gemeinsames Ziel schien Keetmannshop. Die Gesamtstärke der zu
erwartenden feindlichen Kräfte mag etwa 6000 Mann betragen haben. Die
geringen hiergegen verfügbaren deutschen Kräfte, etwa 400
Gewehre, sollten als Nachhuten fechtend langsam auf Keetmannshop
zurückgehen.
Auch die deutsche Stellung bei Aus, an der von Lüderitzbucht ins Innere
führenden Bahn (Major Bauszus), wurde auf Befehl des Kommandos
geräumt, da die geringen dort stehenden Kräfte seitens des weit
überlegenen Gegners leicht der Vernichtung ausgesetzt schienen,
während sie im Norden, wohin sie sofort herangezogen wurden, dringend
notwendig waren.
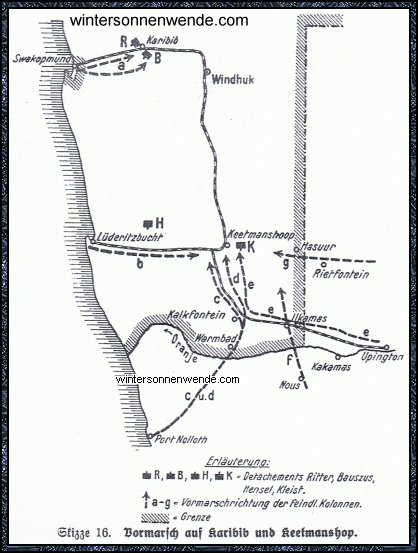
[373]
Skizze 16: Vormarsch auf Karibib und Keetmanshop.
|
Ende März 1915 entwickelte sich das nebenstehende Gesamtbild
(siehe Skizze 16).
Etwa Anfang April überschritten die feindlichen Gros ziemlich gleichzeitig
die deutsche Grenze: Der allgemeine Angriff von Süden her hatte damit
begonnen.
Die Stellung von Aus wurde von Major Bauszus geräumt; er zog sich mit
seinem Detachement befehlsgemäß zum Widerstand gegen die von
[373] Walfischbay
vordringende feindliche Hauptmacht heran. So mußte der Süden der
Kolonie planmäßig vor der feindlichen Übermacht
geräumt werden; die einzige mit den geringen verbleibenden Truppen noch
lösbare Aufgabe war hier, mit Nachhuten den Feind aufzuhalten und sein
Nachdrängen zu verzögern. Im wesentlichen waren zwei
Nachhutgruppen gebildet. Die kleinere, Hensel (westlich) und die
größere, v. Kleist (östlich). Die Einzelabteilungen
letzterer lieferten sich mit dem zunächst nur langsam nachrückenden
Gegner zahlreiche kleine Nachhutgefechte, mit der Rückzugsrichtung
zunächst auf Keetmanshop. Auch dies mußte bald aufgegeben
werden und Hauptmann v. Kleist ging auf Gibeon zurück. In der
Nacht vom 26. zum 27. April sprengte jedoch der scharf aufgebliebene
Engländer die Bahn nördlich von Gibeon, und es kam nun an dieser
Stelle, am Bahnhof [374] Gibeon, zu einem
schweren Gefecht, in dem das kleine aus drei Kompagnien und einer halben
Batterie bestehende Nachhutdetachement v. Kleist von insgesamt 6
Regimentern umfassend angegriffen wurde und sich nur mühsam der
Umklammerung durch zugweisen Abmarsch nach Norden entziehen konnte.
Dieses Gefecht kostete der deutschen Truppe mehr als ein Viertel ihrer
Frontstärke; es war das verlustreichste des ganzen
südwestafrikanischen Feldzuges.
In dieser hochkritischen Periode: erfolgreicher breiter Vormarsch des Feindes im
Süden, und gleichzeitiger entscheidender Vorstoß im Norden von
Swakopmund her, trat auch, gewiß nicht zufällig, eine innere Krisis
hinzu: der Aufstand der Rehobother Bastards. Die Regierung hatte mit diesem
Stamm (vgl. S. 363) eine
Verwendung der Bastardtruppe "nur im eigenen Lande" vereinbart und ihm
deshalb seine Waffen belassen. Es waren dies 150 Bastardsoldaten unter
zunächst rund 30 weißen Führern, welch letztere jedoch
allmählich mehr und mehr zur Ausfüllung anderswo entstandener
Lücken verwendet werden mußten. Kräftige und geschickt
einsetzende englische Propaganda und starke Aushebung von Zugochsen
deutscherseits bewirkten, daß der Bastardhäuptling April 1915 mit
Botha zu verhandeln begann und sich mit seinem Stamm den Engländern
verschrieb. Leider wurden die Unbotmäßigen deutscherseits nicht
scharf angefaßt; die Regierung unterhandelte sogar noch, als schon eine
Anzahl deutscher Farmer von den Bastards ermordet worden war.
Schließlich wurden doch einige Kompagnien, außerdem das
inzwischen in dortiger Gegend eingetroffene Nachhutdetachement Hensel gegen
die Bastards angesetzt, diese auch aus ihrer Stellung bei Kl. Aub (nördlich
Rehoboth) geworfen; der Erfolg konnte aber nicht ausgenützt werden, da
die Unionstruppen mittlerweile dicht herangekommen waren und sogar eine,
allerdings unberittene, Kompagnie (4. Ers. Komp.) abgeschnitten
und gefangen genommen hatten. Die Vereinigung der Bastards mit den
Unionstruppen war somit nicht mehr zu verhindern.
Nach dem Gefecht von Riet-Jakalswater (vgl. S.
371) war Botha, dem ja eine zehnfache Übermacht zu Gebote
stand, trotz außerordentlicher Verpflegungsschwierigkeiten, der Bahn
folgend weiter vorgerückt und hatte mit seiner vordersten Gruppe
Trekkopje erreicht. Die Unionsstreitkräfte dieser Gruppe in Trekkopje
schienen den gegenüberstehenden deutschen Kräften nicht erheblich
überlegen, ihre Möglichkeit, Verstärkungen rechtzeitig
heranzuziehen, schien gering. Dies veranlaßte das Kommando, den Major
Ritter mit einem Detachement von insgesamt etwa 700 Gewehren zu einem
Überfall auf das Unionslager bei Trekkopje zu entsenden. Ob Verrat im
Spiele gewesen, oder ob aus anderen Gründen, Ritter stieß auf ein
alarmiertes wohl vorbereitetes Lager, zu dem auch bereits Verstärkungen
herangeholt waren. Der Kampf spielte sich so unter schwereren Umständen
ab als gedacht, insbesondere machten zwei frisch aus England eingetroffene
Panzerfahrzeuge mit ihren Maschinengewehren den ungedeckt in der blanken
Ebene liegenden deutschen Truppen viel zu schaffen. So scheiterte selbst Ritters
mit der blanken [375] Waffe versuchter
Sturm, so große Anerkennung an und für sich dieses mutige
Unternehmen verdient. Der Kampf, der auf beiden Seiten ungefähr die
gleichen Verluste gezeitigt hatte, mußte abgebrochen werden; das
Detachement Ritter ging in nördlicher Richtung, aus der es gekommen war,
zurück.
Eine örtliche Verteidigung Windhuks wäre militärisch nutzlos
gewesen; es wurde daher aufgegeben, Regierung und Kommando gingen nach
Norden, nach Omaruru, die Bevölkerung blieb in Windhuk
zurück. - Nach dem Gefecht von Trekkopje war Botha ziemlich
schnell nachgerückt, und zog am 13. Mai in Windhuk ein.

So war jetzt der größte Teil der Kolonie, mit der Landeshauptstadt, in
Feindes Hand. Die Mehrzahl der Farmen war verlassen, an ihnen hielten sich die
Eingeborenen schadlos. Auch die Großfunkenstation von Windhuk war
verloren, die letzte, wenn auch dürftige Verbindung nach außen
zerstört und das Land den unkontrollierbarsten Gerüchten über
die Vorgänge in der Heimat preisgegeben. Daß diese nur
beunruhigend und niederdrückend sein konnten, dafür sorgte die
englische Propaganda. So erschien der Versuch der verantwortlichen
Männer, Gouverneur und Kommandeur, durch Unterhandlungen der
Besetzung und Verwüstung wenigstens des nördlichen Teils der
Kolonie vorzubeugen, gerechtfertigt. Doch Botha verlangte rundweg und restlos
die Auslieferung des ganzen Schutzgebietes. Der Gouverneur lehnte kurz ab;
damit waren die Verhandlungen zu Ende; ein für die Dauer der
Verhandlungen geschlossener Waffenstillstand wurde am 21. Mai
gekündigt und der Kampf ging weiter.
Es kam jetzt darauf an, die dem Gegner um das Zehnfache unterlegene Truppe so
lange als möglich kampfkräftig zu erhalten; nur auf diese Weise,
d. h. ungeschlagen, war sie bei einem Kriegsende in
Europa - die einzige hoffnungsvolle Lösung, die es noch
gab - ein Faktor, der ins Gewicht fiel. So mußte ein
Entscheidungskampf so lange als möglich hinausgeschoben, alle
Kräfte mußten zusammengeschlossen und durch Auffüllung
verbessert werden. Aus diesen Erwägungen heraus wurden die
Hauptkräfte zunächst mit einem größeren Ruck nach
rückwärts genommen. Es war dies die Gegend von
Kalkfeld; dort waren die Verteidigungsverhältnisse günstig,
da die nach Süden und Südosten vorgelagerten, nur durch Pforten
passierbaren Gebirgszüge das feindliche Vorgehen aus diesen Richtungen
erschwerten. "Buschpatrouillen", d. h. kleine Streifabteilungen mit voller
Bewegungsfreiheit, suchten von dort aus, meist unter übergroßen
Anstrengungen, unter Hunger und Durst, dem Gegner Abbruch zu tun; immerhin
konnten dies bei den schwachen deutschen Kräften eben nicht viel mehr
wie Nadelstiche sein. In der Gegend Kalkfeld-Waterberg sollte nun so lange als
möglich das Vordringen der Unionstruppen aufgehalten, endgültige
Entscheidung jedoch durch Ausweichen nach Norden vermieden werden. Auch
der Gedanke, nach Nordosten ins deutsche und von da ins portugiesische
Ambo-Land zurückzugehen, [376] wurde reiflich
erwogen, mußte jedoch, da in diesem Lande furchtbarste Hungersnot
herrschte, fallen gelassen werden. - Die gesamten jetzt
zusammengezogenen Truppen bestanden aus 17 berittenen Kompagnien, 4
Fußkompagnien und 9 Batterien, die in 5 Abteilungen gegliedert wurden; an
Zahl allerdings die stärkste Macht, die bisher in der Kolonie
zusammengezogen gewesen war, aber nicht der Zusammensetzung nach; es war
im buchstäblichen Sinne das letzte Aufgebot an Mann und Pferd. Dem
Gegner standen hiergegen 9 Infanteriebrigaden mit reichlicher Artillerie und allen
Sondertruppen: Pionieren, Fliegern, Kraftwagen, auch Panzerkraftwagen, und vor
allem bestem Pferdematerial zu Gebote.
Am 18. Juni traten die Gros der Truppen Bothas aus der Linie
Okahandja - Otavibahn in nordöstlicher Richtung den
gemeinsamen Vormarsch an mit dem ersichtlichen Bestreben, die deutsche
Truppe bei Waterberg einzukreisen und einzufangen. Deshalb entschloß
sich das Kommando in die Gegend von Otavi auszuweichen, das von den Truppen
gegen Ende des Monats Juni erreicht wurde. Hier war für den Gegner das
zunächst erstrebenswerteste Ziel Otavifontein (östlich Otavi
gelegen), ein bevorzugter Platz der Kolonie mit Wasser, Kulturanlagen jeder Art,
Gebäuden, Kasernen, Weiden, kurz, ein idealer Stützpunkt. Dieser
sollte daher festgehalten werden, womit das Detachement Ritter (etwa 700
Gewehre) beauftragt wurde. Doch die Truppe hatte mit der Einrichtung dieses
Platzes kein Glück; der Gegner folgte außerordentlich schnell, dank
guten Führern, über die er, leider aus den früheren Reihen der
Deutschen, verfügte. Der Ausbau der Stellung bei Otavifontein war daher,
als der Gegner erschien, kaum begonnen, was um so schlimmer war, als die
Stellung eine zu den geringen Kräften übergroße Ausdehnung
hatte. Bereits am 1. Juli früh griff der Gegner mit erheblicher
Übermacht an, und konnte nach hartem fünfstündigen Gefecht
Otavifontein nehmen. Botha rückte noch am selben Tage dort ein und zog
alsbald dort gegen 15 000 Mann mit schwerer Artillerie, einem
großen Kraftwagenpark und allem erdenklichen sonstigen Kriegsbedarf
zusammen.
Der Rest der deutschen Truppen war damit bis in die Gegend
Tsumeb-Namutoni zurückgedrückt. Die Lage der Truppen war
hoffnungslos geworden; ein weiteres Ausweichen in den unbewohnten keinerlei
Verpflegung besitzenden Norden war ausgeschlossen. Deshalb wurde am 6. Juli
Waffenstillstand vereinbart und, nach Rücksprache des Gouverneurs und
Kommandeurs mit General Botha, am 9. Juli dessen Bedingungen angenommen:
Kapitulation der Truppe, Übergabe der Artillerie und des
Schießbedarfs. Die aktiven Offiziere wurden auf Ehrenwort entlassen,
ebenso sämtliche Mannschaften des Beurlaubtenstandes, die aktiven
Mannschaften wurden interniert. Zur Übergabe gelangten 280 Offiziere,
4300 Mann, 40 Geschütze. Verlust der Truppe waren (Tote, Verwundete,
Gefangene zusammen): rund 1000 Köpfe. Der gegnerische Verlust
dürfte um etwa 50 v. H. höher zu schätzen
sein.
So ging der elfmonatige
Kampf in Südwestafrika zu Ende. Der Kampf
[377] hier - dies
muß ehrlich ausgesprochen werden - läßt sich dem
tapferen Ringen in Kamerun, oder gar dem unvergleichlichen Heldenkampf in
Deutsch-Ostafrika in keiner Hinsicht an die Seite stellen. Die Verhältnisse
lagen aber auch viel ungünstiger, und namentlich ein Umstand, an den
wenige im Frieden gedacht haben, ist auch in dieser Kolonie, allerdings hier in
negativem Sinne, in Erscheinung getreten: daß eine farbige, gut
disziplinierte, treue Eingeborenentruppe auch im Kampfe gegen einen
europäischen Gegner viel verwendbarer und leistungsfähiger ist. Der
Eingeborene ist eben im eigenen Lande dem eingewanderten Weißen als
Soldat weit überlegen, wenn er gut geführt wird; und hieran hat es,
wie die anderen Kolonien beweisen, den Deutschen wahrhaftig nicht gefehlt.
Aber die eigenen Verluste wie die noch erheblicheren des Gegners beweisen,
daß auch die südwestafrikanische Schutztruppe tapfer bis zum Ende
gekämpft und nur vor überwältigender Übermacht die
Waffen gestreckt hat.
|