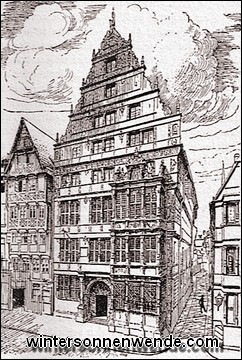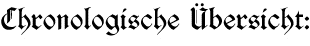|
[Bd. 2 S. 35]

Die Bedrohtheit Deutschlands in der Gegenwart hat von den damaligen Bedrängnissen aus Westen und Osten noch manches bewahrt. Ludwig XIV., von Leibniz der allerchristlichste Kriegsgötze (Mars christianissimus) genannt, war der Christenheit kein Helfer gegen den Osten, der damals als Türkengefahr vor allem die Kaiserstadt Wien bedrohte. Er war zumeist Nutznießer dieser Bedrängnisse, er konnte so seine Macht gewalttätig am Rhein mißbrauchen. Leibniz hat die französische Politik, die beteuerte, daß sie kriegerisch nur aus Streben nach "Sicherheit" sei, wohl als erster durchschaut: Frankreich sucht mit dem Gewinn, den der Krieg bringt, die Anerkennung, die der Friedfertigkeit gebührt (Vorwort zum Codex diplomaticus). Als Leibniz in Mainz war, warfen die kommenden Gewalttätigkeiten Frankreichs ihren Schatten voraus. Gab es ein Mittel, sie vom Rhein [36] abzulenken? Dies zu versuchen, ging Leibniz nach Paris. Ein verlockendes, ablenkendes Ziel für die französische Eroberungspolitik konnte, so schien es ihm und Boineburg, Ägypten sein: für den allerchristlichsten König ein prunkender Kreuzzug und Beutezug. Für Deutschland ein Schachzug ersten Ranges, denn so würden die Franzosen vom Rhein, die Türken von der Donau abgelenkt. Doch trotz der Vielseitigkeit seiner Verlockungen konnte dieser Vorschlag nicht einmal das Ohr von Ludwig XIV. gewinnen. Statt in Paris eine politische Anregung zu geben, empfing Leibniz dort sowie in England und Holland, wohin ihn seine Wanderjahre gleichfalls führten, die bedeutsamsten geistigen Anregungen. Deutschland hatte noch kaum rechte Kenntnis genommen von den neuen Eroberungen der Wissenschaft und von den Gedanken, die zu einer neuen Weltanschauung drängten. In Paris, wo so viele Große der Mathematik, der Naturwissenschaft, der Philosophie beisammen waren, fand Leibniz den Zugang zu ihnen, um – eben noch Lehrling – in jäher Entfaltung zur Meisterschaft zu gelangen. Er schuf in der Infinitesimalrechnung ein Verfahren, das mit Größen zu rechnen vermag, die kleiner sind als jede angebbare Größe. Dies war der Schlüssel zu den Pforten, vor denen die damalige Wissenschaft ratlos und ungeduldig stand. Und doch hat Leibniz mit seiner Leistung, die der Forschung unabsehbare Weiten erschloß, fast mehr Kränkung als Ehre geerntet. Denn er hatte Newton zum Nebenbuhler. Als Napoleon erfuhr, daß ihm Leibniz' ägyptischer Plan um mehr als hundert Jahre vorausgeeilt war, sagte er mit eifersuchtsloser Anerkennung, daß Leibniz zu allen großen Plänen geboren war. Aber mit Newton, dem Napoleon der Wissenschaft, zu wetteifern, nahm kein gutes Ende. Zumal da Newton im stillen unbestreitbar einen Vorsprung hatte. Während sich dieser über sein Verhältnis zu Leibniz in Schweigen hüllte, wurden mit der Zeit Vermutungen und schließlich Vorwürfe laut, er sei durch Leibniz bestohlen worden. Die Akademie der Wissenschaften in London erkannte Newton die strittige Ehre der Entdeckung uneingeschränkt zu. Ihr Urteil, durch das Leibniz verurteilt schien, wollte nicht parteiisch sein und war doch in einer für die Folgezeit unfaßbaren Weise irregeführt. Denn Newtons Verfahren ist keine ausreichende Vorwegnahme der allein maßgebend gewordenen Rechnungsweise von Leibniz. Das Urteil der Londoner Akademie ist obendrein angreifbar auch im Tatsachenbericht, den es zugrunde legt. Es sind mittlerweilen mancherlei Irrtümer zutage getreten, die sich in der unwahrscheinlichsten Weise eingeschlichen hatten. Mit ihrer Richtigstellung ist die sachliche Ehrenrettung von Leibniz auch geschichtlich ergänzt. Als Leibniz im Jahre 1676 nach Abschluß seiner Wanderjahre, des kurmainzischen Amtes schon seit geraumer Zeit ledig, nach Deutschland zurückkehrte, trat er als Bibliothekar und Jurist in den Dienst des Hauses Hannover, in dem er bis ans Lebensende, also vierzig Jahre lang verblieb. Der Herzog Johann Friedrich, der ihn berufen hatte, starb schon 1679. Sein Nachfolger Ernst August war gleich ihm ein wohlwollender Herrscher. Verständnis und vertraute [37] Freundschaft fand Leibniz bei der Kürfürstin Sophie und ihrer Tochter Sophie Charlotte, die Preußens "philosophische Königin" wurde.
Der Fürstin Sophie war wohl zu danken, daß Leibniz seine Stellung am Welfenhofe so gestalten konnte, daß ihn sein amtlicher Pflichtenkreis nicht allzusehr beengte, sondern Zeit ließ zu zahlreichen Reisen und zur Riesenarbeit seines wunderbar vielseitigen Schaffens. Wurden die Freiheiten, durch die sich Leibniz der amtlichen Beengung entwand, nicht immer gerne zugestanden, so blieb er doch zumeist unbehelligt, zumal sich seine Dienste vielfach bewährten. Leibniz war nicht unbeteiligt am Aufstieg des Welfenhauses: 1692 wurde Ernst August Kurfürst. Sein Sohn und Nachfolger Georg Ludwig bestieg 1714 als erster der "vier George" den englischen Thron. Doch dieser Aufstieg wurde für Leibniz der Absturz in Ungnade. Der nüchterne, strenge, soldatische Georg Ludwig war ohnedies ungehalten, daß sich Leibniz die Freiheit nahm, sein Amt als Nebenamt anzusehen. Auch wurde seine Unzufriedenheit mit Leibniz durch dessen Mißliebigkeit in England wohl noch bestärkt. Leibniz behielt zwar seine Stellung in Hannover auch nach dem Weggang des Königs, doch bekam er strengen Befehl, seines Amtes zu walten und vor allem die Geschichte des Welfenhauses zu vollenden. Auf der Höhe seines Lebens hatte er sich zu diesem Werke verpflichtet, Reisen, Quellenstudien, Durcharbeitung eines ungeheuren Stoffes hatten wertvolle Aufschlüsse gebracht und ihn zu einem Geschichtsforscher gemacht, der bahnbrechend hätte wirken können. Aber das Werk, gestört und Störung verursachend, näherte sich nie dem Abschluß und [38] wurde zur Pein. Leibniz hätte gern beizeiten Abschied von Hannover genommen. Jedoch der Kaiserhof in Wien und all die andern Höfe, die ihn ehrten und seine Besuche willkommen hießen, hatten kein rechtes Amt für ihn: das Verdienst, Leibniz bedeutsam gefördert zu haben, verblieb ungeteilt beim Welfenhaus.
Es war nicht Leibniz' Sache, in beschaulicher Zurückgezogenheit das geschichtliche Leben aus der Ferne zu betrachten. Er war ein politischer Mensch voll Tatendranges. In einer demokratischen Zeit kann man allenthalben ins Geschehen eingreifen. In anderen Zeiten – das zeigt aufs neue die Gegenwart – muß man die Stätte der Macht aufsuchen. Leibniz war zu vielseitig, um nur Denker zu sein. Doch war er in seiner Vielseitigkeit so einstimmig mit sich, daß sein politisches Wollen durchaus philosophisch war. Eben darum waren seine großen Pläne zum Scheitern verurteilt – sie sind von einem Gedanken beherrscht, den bis zur Gegenwart kein sogenannter Wirklichkeitsmensch ernst genommen hat. Leibniz ist bekannt als Friedensfreund und Friedensstifter. Dazu bestimmte ihn die Einsicht, nicht bloß die Neigung. Angesichts der Unvernunft, die den Willen zur Macht in Gewalttat, Übermut, Ungerechtigkeit verstrickt, bis schließlich die Vergeltung fällig wird, war Leibniz der Überzeugung, daß zur großen Politik vor allem Vernunft gehört. Diese seine Überzeugung findet in der Gegenwart erstmalig Verständnis. Europa hat so sehr in der Zwietracht seiner Belange geschwelgt, daß es nun offensichtlich in Gefahr ist, zur Belanglosigkeit abzusinken. Im Bewußtsein dieses drohenden Schicksals spricht heute mancher Staatsmann, als wäre er bei Leibniz in die Schule gegangen. Es gilt schon nicht mehr als weltfremd, der Stimme der Vernunft Gehör zu geben. Leibniz war sich klar darüber, daß die Unvernunft etwas Urwüchsiges ist. Aber sie ist unfruchtbar. Bei dieser seiner Überzeugung schien ihm auch die Zwietracht der christlichen Kirche, die sich im Dreißigjährigen Kriege noch nicht genugsam ausgetobt hatte, unerträglich. Mitzuhelfen am Werke der Verständigung, das den Katholizismus und die evangelischen Kirchen wieder vereinigen sollte, war ihm eine Aufgabe, an die er einen guten Teil seines Lebens dahingab. Er ist im Nachdenken über die Abgründe des Glaubens und der Glaubensspaltung ein großer Theologe geworden. Wie kaum einer ist er in den Widerstreit der Lehren eingedrungen, um die Einheit eines verbindenden Sinns zu finden. Als aber der Versöhnung die Unnachgiebigkeit französischer Bischöfe in den Weg trat und als dann [39] die neu bestärkte deutsche Uneinigkeit es nicht einmal zur Einigung der evangelischen Kirchen kommen ließ, wurde auch in der Kirchenpolitik offenbar, daß Leibniz seiner Zeit zu sehr vorauseilte. Er hat sich aber nicht mit der trügerischen Hoffnung getröstet, daß der "Fortschritt" von selbst komme oder durch Aufklärung billig zu haben sei. Er hat im Gegenteil das, was dann wirklich kam, erraten. Im Jahre 1704 sagte er den in der Zwietracht der Kirchen erstarkenden Gedanken der Aufklärung das Schicksal, das sie bringen würden, voraus: "Sie bahnen den Weg für die allgemeine Revolution, die Europa bedroht." Ein politischer Mensch war Leibniz sogar der Wissenschaft gegenüber. Es war ihm nicht genug, als Theologe, Jurist, Philosoph, Mathematiker, Physiker, Geologe, Psychologe, Geschichtschreiber, Sprachforscher selbst Großes zu leisten. Auch bei der Wissenschaft kam es ihm auf den Ausbau der Gemeinschaft an, damit durch die Zusammenarbeit vieler ihr Werk ins Große wachse. Deshalb war er darauf aus, Akademien zu begründen. Sie sollten als Gemeinschaften ("Sozietäten"), die miteinander Gemeinschaft machen, Forschung, Erfindung und ihre praktischen Auswertungen fördern. Gelang ihm bei Lebzeiten die Gründung der Berliner Akademie, so eilte auch dies der Zeit voraus, erst ein Jahrhundert später fing sie an, wirklich Bedeutendes zu leisten. Zu Leibniz' Bemühen, Forschung und Erfindung planmäßig zu fördern, gehört auch sein Grübeln und Hoffen, die Grundlagen einer allumfassenden, allverständlichen Zeichenschrift zu finden. Ihm schwebte der Gedanke vor, es könnten, ähnlich wie bei den Zahlen und ihren leichtverständlichen Zeichen, in der Natur Bildungsgesetze der einfachen und grundlegenden Tatsachen bestehen, so daß es gelingen müßte, das Wesentliche im Beharren und Vergehen durch eine allumfassende Zeichenschrift auszudrücken. Man hat bis zur Gegenwart diesen Gedanken phantastisch und unklar gescholten, ohne zu bemerken, daß mittlerweile durch die chemische Formelschrift ein beachtlicher Teil des von Leibniz Geforderten tatsächlich verwirklicht wurde. Der Weg, auf den Leibniz die Naturwissenschaft führen wollte, scheint immer wegsamer zu werden. Auch ist zu beachten, daß Formeln eine zauberhafte Kraft haben, Entdeckungen und Erfindungen anzuregen. Als Leibniz im Alter von siebzig Jahren starb, besaß er den Weltruhm einer Universalität ohnegleichen, obwohl nur Bruchstücke seines Wirkens und Forschens bekannt waren. Seitdem sind in immer neuen Anläufen von seinen Schriften zahlreiche Ausgaben erschienen, die – auch zusammengenommen – unvollständig blieben. Seine Hauptwerke und die Hauptstücke seines ungeheuren Briefwechsels sind zwar nach und nach veröffentlicht worden, es steht aber zu befürchten, daß im Jahre 1946, wenn wir Leibniz' dreihundertsten Geburtstag mit vielen Worten feiern werden, die Gesamtausgabe seiner Werke, Entwürfe, Briefe noch nicht vollendet sein wird. Der Plan, durch eine übernationale Gemeinschaftsarbeit von Akademien diese Gesamtausgabe zu verwirklichen, ist zerschlagen. "Wer nur meine veröffentlichten Werke kennt, kennt mich nicht." Dieses Leibniz-Wort gilt, wie [40] Couturat, einer der hervorragendsten französischen Kenner, gezeigt hat, in mancher Hinsicht so lange, bis die Gesamtausgabe erschienen ist: "Sie erst wäre die Auferstehung eines Genius, der, weit und reich wie die Natur selbst, sie umfaßte und durchdrang. Es wäre die Auferstehung des größten Geistes der Neuzeit und vielleicht aller Zeiten. Oder vielmehr: es wäre eigentlich seine erste Erscheinung." Leibniz' Gedanken zur "Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache" zeigen, wie sehr er ihre Vorzüge zu schätzen wußte, ihren "Sprachbrauch, Sprachschatz, Sprachquell" zu erforschen und die damalige Verderbnis zu bekämpfen versuchte. Daß er gleichwohl zumeist lateinisch oder französisch schrieb, war zum Teil durch sein Bemühen, in die Weite zu wirken, bedingt, hatte aber noch einen tiefer liegenden Grund, den er selbst hervorgehoben hat: Die deutsche Sprache besitzt ihre Kraft im Urwüchsigen, Naturnahen, Lebensnahen. "Es ereignet sich aber einiger Abgang bey unserer Sprache in denen Dingen, so man weder sehen noch fühlen, sondern allein durch Betrachtung erreichen kann." "Weil nämlichen die Gelehrten fast allein mit dem Latein beschäfftiget gewesen und die Mutter-Sprache dem gemeinen Lauff überlassen." So kam es, daß sie zu Leibniz' Zeit dem Ausdruck philosophischer Gedanken Schwierigkeiten bereitete. Dem wurde späterhin durch zahlreiche Fremdworte abgeholfen, obgleich die Sprachentwicklung bis zu Kant die Anregungen von Leibniz befolgte, in der Aufnahme von Fremdwörtern Maß hielt und "der deutschen Sprache Reichtum, Reinigkeit und Glanz" zur Geltung zu bringen versuchte. Der Leibnizianer Christian Wolff und der ihm hier nahestehende Gottsched haben Vorbildliches für die philosophische Schulsprache getan. Man muß sich daran halten. Das wird auch Leibniz zu einer verspäteten Wirkung verhelfen. Es ist das Schicksal von Leibniz gewesen, daß vorzugsweise das blendende Vielerlei seiner Leistungen bewundert wurde. Er wurde als der größte "Polyhistor" gepriesen. Seine wahre Größe aber ist ganz anderer Art. In der Fülle dessen, was ihn gefesselt zu haben scheint, offenbart sich die Einheit seines Wesens, das dem Wesentlichen zugewandt, eben darum die Fülle bezwingen konnte. Er ist weltoffen wie keiner, doch mit einer einzigartigen geistigen Ursprünglichkeit in der Gestaltung. Er ist schlechthin faustisch und in seiner Ausgeformtheit trotzdem klassisch. Wer nur auf seine Werke achtet, steht unter dem Eindruck einer Vielheit, die naturgemäß eine Summe ist. In seiner Weltanschauung ist aus der Fülle ein Ganzes geworden, dessen Wesenszüge der Renaissance verwandt sind. Der Geist der Renaissance ist faustisch und strebt gleichwohl zur klassischen Formvollendung, zur Harmonie von Stoff und Form, von Sinnlichkeit und Sinn, von Vielheit und Einheit. Leibniz, dem Welt und Weltgeschichte als sinnvollstes Ganzes gilt, ist zutiefst deutsch in seiner Sehnsucht nach Harmonie, doch wirkt sein Glaube an ihr geheimes Dasein meist anstößig. Daß er das heillos Böse, die unabwendbare Zerrissenheit, das unselig Tragische leugnet, sagt Menschen, die in stetem Kampf [41] mit sich und der Umwelt stehen, nicht zu. Seine Weisheit hat die Wollenden und die "Wissenden" gegen sich. Aber für sich vielleicht die Wahrheit. Und – Goethe. Im Barock, dem man Leibniz' Weltanschauung nicht zurechnen sollte, ist die Fülle der individuellen Einzelheiten dem überwältigenden Gesamteindruck untergeordnet. So ließ der Barockgeist auch in der Politik die Einheit eines herrschenden Willens über die Vielheit triumphieren. Gegen alle Übermacht der Einheit und Einheitlichkeit nahm die Aufklärung, deren zersetzenden Individualismus Leibniz heraufkommen sah, den Kampf auf: die Vielheit wollte die Macht an sich reißen. Weder die Vergewaltigung noch die Unbeherrschtheit der Individuen kann das Richtige sein. Die Geschichte schwankt zwischen beidem hin und her, bald das Unheil dieser, bald das Unheil jener Einseitigkeit verfluchend. Leibniz erkannte, daß keine Nötigung besteht, jeweils im entgegengesetzten Unheil das Heilmittel zu suchen. Das richtig verstandene Recht der Vielheit kann sehr wohl im Einklang stehen mit dem richtig verstandenen Recht der Einheit. Dieser Einklang besteht, wenn die Vielheit zur Gemeinschaft verbunden, ein Ganzes bildet, dem jedes Glied fügsam zugetan, nicht hörig Untertan ist. Was Leibniz fand: das Vorbildliche der Gemeinschaft, ist gerade das, was die Gegenwart sucht. Leibniz' Bemühen, das Bedeutsame der Gemeinschaft, für die er freilich vielerlei Worte gebraucht (Ganzes, Zusammenstimmung, Harmonie, Vollkommenheit usw.), weltanschaulich zur Geltung zu bringen, kann der Gegenwart das Verständnis für ihn erschließen und kann ihr verständlich machen, daß nur eine Weltanschauung, die tief und ergreifend ist, tief und nachhaltig ins Leben einzugreifen vermag. Gemeinschaft ist für Leibniz in jeder Hinsicht der beherrschende Begriff, aus dem er Welt und Weltgeschichte und die Gottheit deutet. Man könnte ebensogut sagen, der Grundzug seines Wesens, der der Vielfältigkeit seines Strebens fast in allem das Gepräge gibt, sei das Bemühen, die Vernunft zur Herrschaft zu bringen. Die Vernunft hält es eben mit der Logik der Gemeinschaft. Leibniz vertraut darauf, daß die Vernunft auch in der Geschichte waltet. Die Geschichtschreibung indes beschränkt er auf das Individuelle (res singulares). Sie soll von ihm Kenntnis geben. Sie soll die Gegenwart aus der Vergangenheit verständlich machen. Sie soll der Zukunft zur Belehrung dienen. Sie soll durch die Kunde großer Taten Ruhmbegier und Tatenfreude immer neu entfachen. (Vorwort der Accessiones historicae.) Als Wissenschaft des vergänglich Individuellen schien ihm die Geschichte verurteilt zu sein, sich auf die Kenntnisnahme des scheinbar Irrationalen zu beschränken. Er stellt darum den "ewigen Wahrheiten" der Vernunft die geschichtlichen Tatsachen, die uns Zufall bleiben, gegenüber. Man könnte meinen, daß Hegel, der die Vernunft unmittelbar auf dem Schauplatz der Geschichte suchte, das vollbracht habe, woran Leibniz verzweifelte. Aber so nahe ihm Hegel steht – von Leibniz stammt das Leitwort, daß alles, was wahrhaft ist, vernünftig sei – im Begriff des Geschichtlichen treffen beide nicht ganz zusammen. Leibniz suchte das geschichtlich Wesentliche im Individuellen, Persönlichsten, Hegel [42] im Überpersönlichen und im Allgemeinen. Leibniz hat das Leben der Völker hoch über das Menschenleben gestellt und der Aufklärung den Vorwurf gemacht, daß sie die Gesinnung untergrabe, "der Vaterlandsliebe und öffentliches Wohl und die Sorge für die kommenden Geschlechter höher standen als das eigene Glück und Leben". Von Leibniz kommt Herders geschichtsphilosophische Würdigung der Völker. Aber sie sind etwas Vergängliches. Das Unvergängliche suchte Leibniz in der unsterblichen Seele, die auf der Wanderung durch unzählige Lebensläufe und in der Wandlung durch alle Schicksale den Sinn der Geschichte zu erfassen desto fähiger wird, je mehr Sinn sie dem eigenen Dasein durch die Hingabe ans Überpersönliche zu geben vermag. Es ist klar, daß diese faustische Forderung an die Geschichte, jeder Seele Spielraum zur unbeschränkten Selbsterweiterung und zu wahrhaft weltgeschichtlichem Wirken zu geben, im Rahmen der Geschichtswissenschaft, die das Vergängliche beschreibt, keine Bekräftigung findet. Seine Geschichtsphilosophie kann eines Tages auch wissenschaftlich Bedeutung gewinnen. Einstweilen ist ihr zuzugestehen, daß sie Natur und Geist zu einem Ganzen zu vereinen sucht. Der geistlosen Weltansicht, die in der Natur nur ein Hin und Her von Massenteilchen, ein Auf und Ab von ziellosen Kräften findet, stellt Leibniz seine Anschauung entgegen: die Natur ist ein Ganzes, gebildet aus einer unendlichen Vielheit kleinster, unvergänglicher Einheiten, die als Gegenstand des Bewußtseins den Stoff der Welt "darstellen", in ihrer Innerlichkeit aber etwas Seelisches sind und im Zustand des Bewußtseins die Welt "vorstellen". Der Stoff der Welt, unter Naturgesetzen stehend, denen Leibniz, auch hier seiner Zeit weit voraus, den Satz von der Erhaltung der Energie zurechnet, bildet die Natur. Die Innerlichkeit der Welt bildet sich in der Weltgeschichte. Die letzten Einheiten, die Mikrokosmen des Kosmos nannte er "Monaden". Vielleicht wurde dieser Ausdruck von Martianus Capella angeregt, der geheimnisvoll von der heiligen Monas, dem Ursprung der Vielheit, spricht. (Leibniz beabsichtigte im Jahre 1673, den Martianus Capella herauszugeben.) Die Monade, wie Leibniz sie denkt, ist anfänglich als bloßes Massenteilchen ein Minimum von Welt und Seele. Doch ein faustisches Minimum: ein dunkler Drang, ins Leben zu treten, mit anderen Monaden sich zum kleinen Ganzen einer Lebensgemeinschaft zu verbinden und als deren führende, belebende und beseelende Monade zum Ichbewußtsein und Weltbewußtsein zu erwachen. "Stirb und Werde": die Gestaltungen des Lebens sind vergänglich, die Monaden sind unvergänglich. Sie sinken in Todesdunkel, wenn ihre Lebensgemeinschaft zerfällt. Sie kehren auferstanden zurück ins Lebenslicht, wenn sie – dienend oder führend – ein neues Leben bilden. Einen höheren Sinn kann das Einzelleben in Gemeinschaften höherer Ordnung gewinnen. Ein Menschenleben vermag führend dem Leben eines ganzen Volkes neue Gestalt oder neuen Gehalt zu geben. Doch vermag ein einzelner ein Volk auch in den Abgrund zu führen. Zum Widersinn, [43] daß die einen zerstören, was die andern aufbauten, kommt noch die Tatsache, daß jede Gemeinschaft, die den Eigensinn ihrer Glieder durch einen höheren Sinn überwindet, einen neuen Eigen-Sinn in die Geschichte trägt, der mit fremdem Eigen-Sinn zusammenprallt. Gegnerschaft, Kampf ums Dasein entsteht, wo immer Individuen, Gruppen, Völker, Kirchen sogar, ihren Sinn durchzusetzen versuchen. Leibniz war sich des Widersinns in jedem Eigensinn, des Unrechts in jedem Lebensrechte bewußt. In seinem Vorwort zum Codex diplomaticus, 1693, verweist er (wie Kant, der ihm folgte) auf den Spötter, der seinem Hause den schönen Namen "Zum ewigen Frieden" gab, doch auf das Schild einen Kirchhof malte. Leibniz' Vorwort zum Codex diplomaticus ist aufschlußreich, weil es zeigt, wie sehr bei seiner Deutung der Geschichte auch Rechtsphilosophie und Religionsphilosophie mitsprechen. Die Welt kann nur durch Gerechtigkeit befriedet und befriedigt werden. Leibniz wird durch die Frage nach dem Wesen des Rechts zur Forderung geführt, daß in der Weltgeschichte jeder zu seinem Rechte kommt und daß jedes Unrecht auf den kommt, der es begangen hat. Leibniz hatte die philosophische Schwäche, es jedem recht machen zu wollen. Und fand, daß man es jedem doch nur insofern recht machen dürfe, als er tatsächlich recht hat. Und daß dies durchzuführen, der Allmacht und der Allwissenheit vorbehalten sei. Und daß sie dazu Zeit brauche: die ganze Zeit der Weltgeschichte. Und daß auch jede Seele die ganze Zeit der Weltgeschichte benötige, um die "universelle Gerechtigkeit" zu erleben und zu erfüllen. Das Fortleben der Seele nach dem Zerfall des Körpers soll nicht als abgeschiedene Unsterblichkeit gedacht werden. Denn Seele ist nur die führende Monade (monas dominans) einer Lebensgemeinschaft. Die gröblich erlittene Seelenwanderung hat Leibniz abgelehnt. Doch ist er mit der Weisheit des Brahmanismus durch etwas Tiefgemeinsames verbunden. Leibniz ist durchdrungen davon, daß alle Vielheit aus der Einheit stammt und zur Vereinigung strebt. Wenn die Welt nur aus Seelen und Seelchen besteht, also kein Nicht-Ich enthält, kann jeder zu jedem sagen: Du bist ich. Auch zum Welt-All kann jeder sagen: Du bist ich. Die Innenwelt jedes einzelnen ist ja Darstellung und Vorstellung der Welt selbst. Auch zu Gott darf jeder sagen: Du bist ich. Dennoch ist für Leibniz die Vielheit kein bloßer Schein, sondern die vielfältige Erscheinung des Wesens, das allen Einzelwesen zugrunde liegt. Einheit und Vielheit bedingen einander. Leibniz hat den Irrtum überwunden, daß jede Vielheit nur im Allgemeinen einig sein kann, doch im Besonderen aller Einzelheiten auseinandergehen muß. Eine Vielheit kann zur höchsten Einheit einer Gemeinschaft, eines Ganzen verbunden sein, wenn alle Einzelheiten sich so ergänzen, daß jede auf ihre besondere Weise den Sinn des Ganzen zur Erscheinung bringt. Alle Einzelwesen können ein Ganzes bilden, in dem keines von ihnen unwesentlich ist. Indem Leibniz so den uralten weltanschaulichen Gegensatz von Vielheit und Einheit aufhebt, versucht er zu zeigen, daß auch die Vollkommenheit das Unvollkommene nicht ausschließt, sondern einschließt. Vollkommenheit ist Einheit in der Mannigfaltigkeit. [44] Die Allvollkommenheit kommt jener höchsten Einheit zu, die alle Fülle des minder Vollkommenen, Unvollkommenen als Ganzes zum Gegenstand hat. Die Allvollkommenheit selbst läßt sich nicht vervielfältigen. Sie muß einzig sein. Gäbe es etwa zwei allmächtige Gottheiten, dann würden sie sich im Wege stehen, sie würden gegenseitig ihrer Macht Abbruch tun, bis sie ganz einig, ganz eins geworden, in keiner Weise mehr entzweit wären. Leibniz gibt der spinozistischen All-Einheit, die zur Allein-heit verurteilt ist, weil für sie das Individuelle völlig unwesentlich bleibt, die Fülle der Einzelwesen, die in ihrer unvergänglichen und unerläßlichen Besonderung so ewig sind wie Gott. Leibniz wird nicht müde zu betonen, daß jede Seele ein kleiner Gott sei. Die Monaden, die letzten Einheiten, sind Gottes Minimum. Er ist ihr Ursprung. Sie sind ursprünglich im ewigen Sinn. Sie sind der Stoff, aus dem die Welt gebildet ist. Als letzte, kleinste Einzelheiten sind sie der bildsamste, also der bestmögliche Stoff. Als Gottes fernstes Abbild stehen sie der ewigen Ruhe am fernsten. Sie sind die Unruhe, die zum
Leibniz hat sein weltanschauliches Hauptwerk "Rechtfertigung Gottes" genannt. (Theodicee 1710.) Die Unsumme des Bösen, des Leidens, des Elends erhebt Anklage gegen Gott. Warum hat er die Welt nicht besser gemacht? Hat seine Güte versagt oder seine Macht? Leibniz antwortet, daß Gott nichts Besseres tun konnte, als die beste aller möglichen Welten ins Dasein zu rufen. Sein Optimismus hat sich nie zu der Behauptung verstiegen, daß in der Welt jede Einzelheit als solche gut und schön sei. Wenn er das Düstere des Lebens minder düster sah als andere, so stand ihm dies zu: seinem Einblick konnte sich vieles verklären. Menschen, die sich schmeichelten, tiefer zu sehen als er, haben seinen Optimismus in Verruf gebracht. Leibniz läßt den Teufel ganz aus dem Spiel, er zeigt aber zugleich, daß und warum eine Welt, die aus Gott stammt, es sich und ihm schwer genug macht. Die Welt, die der höchsten Vernunft entsprungen ist, gibt jeder Unvernunft Raum, solange die innerliche Vereinzelung besteht. Doch sieht Leibniz in der Unvernunft schon das erste Dämmern der Vernunft. Als äußerste Niederung Gottes sind die Monaden das Höchstmaß des noch wirksamen, noch wirklichen Dunkels. Die vollkommene Finsternis wäre etwas Unwirksames, wäre nichts. Indem sich aus der Vielheit des in der Vereinzelung ohnmächtig Kleinsten Gemeinschaften bilden, wird mit der äußersten Vereinzelung auch das Äußerste des Dunkels überwunden. Doch jedes Ganze, das sich bildet, ist von der Umwelt abgesondert und bedarf ihrer dennoch, ist in seiner Bedürftigkeit leidend, in seiner Ganzheit angreifbar, ist zahllosen feindlichen Schicksalen ausgesetzt. Auch herrscht in jedem Lebensraum, je selbstbewußter seine Bewohner sind, desto bewußter der [45] Kampf ums Dasein. Geraten mit all dem viele Leiden in den Kelch des Lebens, ihn manchmal bis zum Rande füllend, so geht dies mit rechten Dingen zu. Jedes Lebensganze ist tätig und leidend. Ob die Tätigkeit das Leiden wert ist, hängt wohl weniger vom Leiden als vom Wert der Tätigkeit ab. Den Teufel aus dem Spiel zu lassen, ist ein abgründiger Optimismus, der die Welt nicht mit der mephistophelischen Weisheit trösten darf: "Dieses Ganze ist nur für einen Gott gemacht." Liest man die Theodicee, dann entsteht aber leicht der Eindruck, daß bei der Rechtfertigung Gottes gelegentlich das Recht der Individuen vergessen sei. Leibniz betont stark, daß man aufs Ganze sehen müsse. Kein Mensch dürfe sich beklagen, wenn sein Schicksal der allgemeinen Bestmöglichkeit hingeopfert wird. Damit scheint die Forderung, daß jedem das Seine werde, preisgegeben. Doch ist die Preisgabe nur scheinbar, denn das Menschenleben gilt nur als Bruchteil des Monadenlebens, in dem sich alles ausgleichen kann. Eine Welt, die unverdorben von Gott kommt, muß es allen recht machen – insoweit sie recht haben! Unmöglich ist es, die Welt so zu gestalten, daß sie dem Eigensinn jedes einzelnen zusagt. Wohl aber kann sie allbefriedigend sein, wenn jeder Vernunft annimmt und sich mit dem bescheidet, was ihm in der Allgemeinschaft zukommt. Man hat die Gerechtigkeit, die in der Welt herrschen sollte, herabgesetzt und herausgefordert durch die Vorstellung, daß das Schicksal in banaler Weise lohnend und strafend mit uns abrechnet. Dieser Banalität scheint sich auch Leibniz schuldig zu machen. Er spricht davon, daß die Gerechtigkeit uns das Glück, das wir verdienen, schuldet – ein Gedanke, den Kant aufgegriffen hat im Postulat, daß die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes dem "Würdigen" Glückseligkeit sichern sollen. Aber ein faustischer Mensch, der Großes geleistet hat, wird statt der Glückseligkeit ein neues Leben und von diesem das Glück erwarten, noch Größeres leisten zu dürfen. So wurde Leibniz von Goethe verstanden: "Wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen." Neben dem Glück, zu wirken, stand für Leibniz allerdings auch ein belohnendes Glück fest: wer die Engherzigkeit der Selbstsucht überwunden hat, dem kommt das Gute, das er andern tut, beglückend zugute. (Felicitatem suam augeat in aliea.) Das bedeutet nicht bloß ein Gefühl der Teilnahme, sondern eine wirkliche Teilhabe. Den Monaden, die zu höherem Sinn in der Gemeinschaft aufsteigen, soll Hingabe als Gewinn bewußt werden. Das Glied eines Körpers ist vom Gedeihen aller Glieder abhängig. Wenn aber die Mitglieder einer Volksgemeinschaft zugestehen, daß Gemeinwohl vor Eigenwohl geht, so widerstrebt dem in zahllosen Fällen die Eigensucht der Individuen. Doch kann Gemeinsinn, zumindest auf höheren Lebensstufen, auch den bewußten Eigensinn überwachsen und überwinden, so daß Gemeinwohl von Eigenwohl nicht mehr zu scheiden wäre. Gerade jene Seelen, die, keinen Lohn erwartend, in der Opferbereitschaft voranstanden, würden vorangehen in der Einsicht, wie sehr Hingabe das Leben lohnt. [46] Wohl bringt jede Gemeinschaft eine neue Selbstsucht in die Welt. Ist sie starrsinnig, dann geht sie unter. Was "vernünftig" ist, kann in eine höhere Gemeinschaft eingehen. Selbst aus der Zwietracht der Völker scheint sich ein Etwas von Eintracht, die je eine Völkerfamilie verbinden könnte, gestalten zu wollen. Ist der Gang der Geschichte so, daß der Eigensinn am Wege liegenbleibt, der Seele aber, die an Besinnung und Gesinnung zunimmt, die Welt immer sinnreicher wird, dann offenbart sich alles Schicksal als Fügung. Eine Welt, bei der kein Teufel und kein völlig sinnloser Stoff die Hand im Spiel hat, berechtigt zu den besten Hoffnungen. Man hat gleichwohl einen falschen Eindruck von Leibniz' Weltanschauung, wenn man meint, es müsse jede Seele im Streben nach Vervollkommnung so ungehemmt fortschreiten, daß jeder nichts zu tun habe, als sich gehen zu lassen. Das Sichgehenlassen bringt keinen über sich hinaus. Man bedarf der Weggenossen und trifft allenthalben Wegelagerer. Man trifft auf dem Wege zum eigenen besseren Selbst die hemmenden Wegelagerer vor allem in den eigenen Untaten. Je mehr man sich in Leibniz' Weltanschauung vertieft, desto offenbarer wird ihr Reichtum. Beherrscht Vernunft die von ihr gestaltete Welt, so herrscht dennoch Unvernunft in jedem Teil, der abgesondert der Umwelt und Mitwelt gegenübersteht. Wollte man Leibniz fragen, warum die Weltgeschichte das Erwachen der Vernunft, mit dem die Unvernunft erst leidvoll zum Selbstbewußtsein kommt, nicht überspringt, um mit den höchsten Lebensstufen zu beginnen, er würde die Antwort nicht schuldig bleiben: das Irrationale gehört zur Fülle des Lebens, das seinen Sinn nur erfüllt, wenn es sich selbst erwirbt, was es zu besitzen trachtet. Leibniz hat das Wesentliche seiner Weltanschauung in einer Formel, im "Satz vom Grunde" zusammengefaßt: Alles, was ist und geschieht, hat einen Sinn, das heißt einen zureichenden Grund. Dies gilt in dreifacher Bedeutung. Wenn die Welt in ihrer Entfaltung, im Gehalt und in der Gestaltung die bestmögliche, die unüberbietbare ist, dann muß sie der Besinnung, der Gesinnung, der Ersinnung alles zu bieten haben, was aus dem Gesichtspunkt der höchsten Werte: der Klarheit, des Guten und der schönen Ganzheit, zu fordern ist. Die sinnliche Wahrnehmung und die Erkenntnis, die unmittelbar auf ihr beruht, ist "verworren", das heißt, sie faßt das Daseiende in einem anschaulichen Bilde auf, das alle Einzelheiten und alle Zusammenhänge verschwimmen läßt. Je gründlicher die wissenschaftliche Besinnung die Natur erforscht, desto besser lernt sie die dunkeln Hintergründe des Geschehens durchschauen. Die verborgenen Einzelheiten und die Gesetze, unter denen sie stehen, hellen sich auf. Die Geltung gerade dieser Naturgesetze und das Sein gerade dieser Welt kann im Ganzen aller möglichen Welten als möglicher und notwendiger Einzelfall begründet sein. Aber jede der Welten, die in der ewigen Klarheit stehen, ist möglich, keine von ihnen ist durch eine logische Notwendigkeit als die zum Dasein berufene ausgezeichnet. Hier greift der Satz vom Grunde in seiner zweiten (teleologischen) Bedeutung ein: unter den zahllosen möglichen Welten kann eine als die wertvollste ausgezeichnet [47] sein. Ihr Dasein hat einen "guten" Grund, wenn sie aus der Niederung und dem Leid der Unvollkommenheit dem All-Guten, der All-Güte, dem Allvollkommenen entgegengeht. Eine Welt, die einen zwingend klaren Wesensgrund und einen bezwingend guten Werdensgrund hat, scheint keiner ästhetischen Begründung mehr zu bedürfen. In der Tat hat Leibniz diese zumeist beiseite gelassen. Doch ist sie unentbehrlich, wenn der Satz vom Grunde nicht am Irrationalen der Anschauung scheitern soll. Die Mannigfaltigkeit der sinnlichen Anschauungen: der Töne, Farben, Düfte usw., kann aus keiner logischen Formel, die ja immer nur Formen der Einheit und Vielheit betrifft, ergründet werden. Der faustische Gedanke von Leibniz, daß die Sinnlichkeit immerhin ein Sinnbild, ein "Gleichnis" des Unvergänglichen gibt und insofern sachdienlich und zweckdienlich sei, ist in keiner Weise fähig, das anschauliche Sosein der Sinnbilder aus dem Sinn, dem sie sich ordnen, abzuleiten. Wohl aber ist eine ästhetische Begründung denkbar: es läßt sich vielleicht keine Sinnesanschauung ersinnen, die ausdrucksvoller, eindrucksvoller, zusammenstimmender wäre. Kant sogar, der die Sinnlichkeit für sinnlos oder sinnwidrig hielt und die entgegengesetzte Lehre von Leibniz tadeln zu dürfen glaubte, sah in der ergreifenden Anschauung des bestirnten Himmels ein Sinnbild, das nicht bloß die Wißbegierde herausfordert, sondern auch ans Gewissen rührt. Wenn die Erscheinungswelt, die Welterscheinung, die unüberbietbar ausdrucksvolle und eindrucksvolle Schöpfung ist – hier darf man von Schöpfung sprechen –, dann gibt sie auf die Frage, warum sie so und nicht anders ist, die Antwort durch ihre unüberbietbare Vollkommenheit. Die drei Bedeutungen des Satzes vom Grunde scheinen weit auseinandergehen. Daß und wie sie dennoch zusammenstimmen, hat Leibniz mit untrüglichem Blick für das Wesentliche erkannt. Sie gehören zusammen, weil jede auf ihre Weise zeigt, wie eine Vielheit zur Einheit eines gegliederten Ganzen – es sei ein System oder eine Lebensgemeinschaft oder ein Kunstwerk – verbunden sein kann. Was einem wahrhaft Ganzen zugehört, bildet in der Vielheit eine Gemeinschaft, ist durch sie sinngemäß geformt und als so Geformtes begründet. Gemeinschaft, Zusammenstimmung ist die Harmonie, die das Wesentliche der Vollkommenheit ausmacht. Je inniger die Gemeinschaft, desto größer ist, formal betrachtet, die Vollkommenheit. Nur der Urgrund aller Fülle ist schlechthin vollkommen, nur das ganz Vereinzelte ist schlechthin unvollkommen: "irrational". Obgleich Leibniz die Bedeutung der Gemeinschaft, der Ganzheit, die vordem wohl nur im platonischen Denken, besonders eindrucksvoll im "Staat" entscheidend zur Geltung gekommen war, von allen Seiten zu betrachten und zu verwerten suchte, scheint seine Auffassung dennoch etwas Starres, Einseitiges zu haben, da sie aus der logischen Klarheit stammt, die in der Mathematik herrscht. Die formale Logik, die nur das Allgemeine der Vereinung und Verneinung, der Einheit und der Vielheit beachtet, hat es selbst mit keiner Gemeinschaft zu tun, doch führt sie zu [48] ihr in der Arithmetik, die der Einheit das Bildungsgesetz der Vielheit abgewinnt. Die Zahl 1, gesellig durch Vervielfältigung, begegnet in der Gemeinschaft, die sie aus sich selbst bildet, nur sich selbst: 2=1+1, 3=1+1+1 usw. Kein Wunder, daß die Folge der natürlichen Zahlen, in der es so einheitlich zugeht, höchste Klarheit besitzt. Doch ist diese Klarheit voll des Wunderbaren. Denn die Zahl 1 trägt die Folge ihrer möglichen Vervielfältigungen auch in sich selbst als die Folge ihrer möglichen Teilungen. Diesen Tatbestand der klarsten, der wunderbarsten Gemeinschaft und Gliederung hat Leibniz auf die Natur übertragen. In jeder Monade ist das Weltall eingeschlossen. Sie bedarf "weder Tür noch Fenster", da kraft der ursprünglichen Harmonie der Weltgestaltung jeder im Innern des andern wirkt und fortwirkt. Gesellig, ungesellig wie die Zahl 1 steht die Einsamkeit der Monade in der Gemeinsamkeit der Natur. Man kann sich dem Eindruck zunächst nicht entziehen, daß hier das Vorbildliche der mathematischen Klarheit aus der Natur ein unnatürliches Zerrbild gemacht habe. Aber es liegt im Wesen jeder wirklich vollkommenen Gemeinschaft, in der alles sinngemäß ist, daß sich die äußere Nötigung zu einem sinngemäßen Dasein und Sosein erübrigt. Für Leibniz war die Selbstgenügsamkeit der weltweiten Monaden keineswegs eine unerwünschte Zugabe ihrer Gemeinschaft – nichts konnte ihm bedeutsamer sein als ein Naturzustand der Einsamkeit, aus dem erst im Gange der Weltgeschichte ein Mehr und Mehr von innerlicher und geistiger Verbundenheit wird. Auch diese Erwägung dringt noch nicht genügend in seine seltsam vielseitige, scheinbar einseitige Auffassung ein: Versenken wir uns in das Wesen einer Lebensgemeinschaft, Willensgemeinschaft, so finden wir im Reiche der Zwecke aufs neue die Tatsache, daß die Teile, die zu einem Ganzen verbunden sind, irgendwie das Ganze in sich enthalten müssen. Wer ernstlich einer wahrhaften Lebensgemeinschaft zugehört, darf getrost sein eigenes Bestes suchen – er wird finden, daß es das Beste aller in sich schließt. Ähnliches gilt sogar im Bereich des künstlerischen Schaffens: bei der Schöpfung jedes Ganzen ist schon im Anfang das Ende vorweggenommen und in jedem Teil das Ganze vorgesehen. Eben darum, weil im sinnvollen Anfang schon das Ende beschlossen liegt, widerstrebt Leibniz dem romantischen Gedanken, die Gottheit selbst als werdend zu denken. Auch Goethe, dem im faustischen Sturm und Drang die Tat voranstand, kehrte im "Faust" schließlich zur Deutung zurück: "Im Anfang war der Sinn."
 |